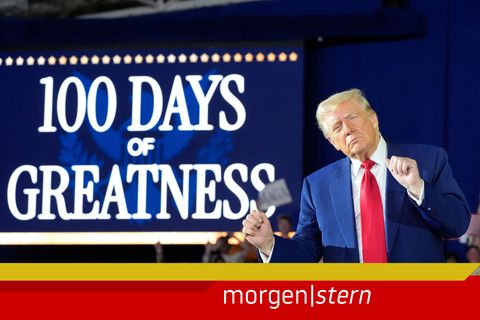In den Straßen von Soyapango, einem Stadtteil von San Salvador in Mittelamerika, lauert der Tod. Gerade hat er wieder zugeschlagen. Wie so oft müssen die Maras von einem ihrer Mitglieder Abschied nehmen. Für den letzten Gang ihres "Bruders" haben sie ihm seine Baseballkappe aufgesetzt, eine junge Frau umklammert den Sarg. Sie weint so hemmungslos, beklagt so lautstark ihren Verlust, dass es kaum auszuhalten ist. Und obwohl der Tod ihr ständiger Begleiter ist, trifft der Verlust eines Freundes die "Mara 18" jedes Mal mit neuer Wucht.
Die "Mara 18" gilt als eine der brutalsten und gefährlichsten Jugendbanden in Lateinamerika. So gefährlich, dass das FBI die Gang sogar als "transnationale Bedrohung" einstuft. Nicht so Christian Poveda. Der renommierte französische Dokumentarfilmer sah in den Jugendlichen etwas anderes. Für ihn waren sie Angehörige einer "verlorenen Generation", die in ihrem Leben nur Ablehnung erfahren haben und die nie eine Chance hatten. Der Regisseur war von dem "hoffnungslosen Leben" der Maras so ergriffen, dass er sich dazu entschloss, einen Film über sie zu machen. Damit ging er ein tödliches Risiko ein, denn einen besonderen Schutz gab es für ihn und seinen Toningenieur David Mendez während der Dreharbeiten nicht.
Jugendliche sterben oder landen im Knast
16 Monate lang fuhr Poveda jeden Morgen in das Mara-Viertel "La Campanera" in Soyapango (El Salvador). Ohne in den Lauf der Dinge einzugreifen, begleitete er die Jugendlichen ins Krankenhaus, zum Gericht, auf Geburtstagspartys, zur Arbeit in die Bäckerei oder eben auf den Friedhof - einer der Hauptschauplätze des Films. Der Filmemacher verstrickte ganz bewusst mehrere Handlungsstränge miteinander und nahm das Leben von El Bambam und La Liro, La Chucky, La Wizard, Little Crazy, Little Scrappy, El Moreno und Spider unter die Lupe. Die Handlung des Films nur auf eine Person zu beschränken, wäre einfach zu riskant gewesen, erklärte Poveda in einem Interview. Zu schnell sterben die Jugendlichen durch die Hand der rivalisierenden "Mara Salvatrucha" oder müssen in den Knast.
"Früher oder später endet man im Krankenhaus, im Gefängnis oder im Loch", sagt einer der Protagonisten bei einer der vielen Trauerfeiern. Und genau das zeigt Povedas Film mit aller Brutalität. Allein während der Dreharbeiten wurden sieben Gangmitglieder auf offener Straße erschossen. Drei der Getöteten waren Protagonisten seines Films, die Poveda monatelang begleitet und gefilmt hatte und die nun direkt vor seinen Augen starben. "Das hinterlässt Spuren", sagte Poveda.
Poveda bezahlt sein Engagement mit seinem Leben
Einen reißerischen Film wollte Poveda aber nicht drehen. Doch dann erlebte er in Soyapango "extrem grausame, unmoralische Dinge", die er nicht ausblenden konnte und ohne die der Film nicht das geworden wäre, was er letztlich ist - eine Dokumentation über das aussichtslose Leben zwischen Hoffnung und Tod. Die "Mara 18" - das sind schließlich nicht nur eiskalte Killer, sondern auch Familienväter, Träumer, Bäcker und Freunde, die die Hoffnung auf ein besseres Leben noch nicht aufgegeben haben. Da ist Janet, Gangname "La Wizard", die durch ein Projektil ein Auge verloren hat und im Krankenhaus verzweifelt auf ein passendes Glasauge hofft. Da ist El Chucky, die mit ihren 19 Jahren bereits allein erziehende Mutter zweier Töchter ist, und die sich wünscht, dass ihre Kinder es einmal besser haben als sie selbst. Da ist El Bambam, der Tätowierer der "18", der im Gefängnis sitzt, auf seinen Prozess wartet und der sich bereits darüber freut, wenn lediglich eine Anklage weniger auf der langen Liste seiner Vergehen steht. Und da ist El Moreno, der sich anlässlich seines Geburtstages an dem Hinterteil einer gut beleibten Prostituierten ergötzt.
Es sind diese kleinen Lichtblicke, die im krassen Gegensatz zu den täglichen Polizeirazzien, blutüberströmten Leichen am Straßenrand und Trauerfeiern stehen. Ein stetiger Wechsel zwischen Hoffnung und Tod eben, durch den Povedas Werk immer wieder auch an Filme wie "City of God" erinnert. Nur mit dem traurigen Unterschied, dass hier alles echt ist. Die Waffen sind geladen, das Blut warm, die Toten ganz normale Menschen und keine Schauspieler, die beim nächsten Kameraschwenk wieder aufstehen und quicklebendig weitermachen wie zuvor.
Christian Poveda war sich der permanenten Gefahr, die von dem Bandenkrieg in El Salvador ausgeht, durchaus bewusst. Doch er wollte den Jugendbanden ein menschliches Gesicht geben und auf den schier endlosen Teufelskreis in den Problemvierteln aufmerksam machen. Sein Engagement für die "verlorene Generation" sollte den Regisseur teuer zu stehen kommen: Am 2. September wurde er auf der Rückfahrt von Dreharbeiten in einem Slum-Vorort von San Salvador mit vier Schüssen in den Kopf getötet - vermutlich von einem Mitglied jener Bande, für die sich der Regisseur auf so einfühlsame Weise eingesetzt hatte.