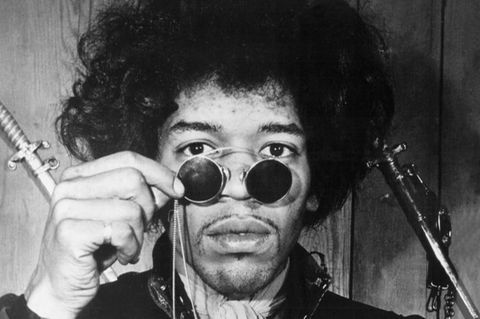Gioacchino Rossini war so etwas wie der Unterhaltungsstar seiner Zeit. Der Italiener agierte als heimlicher Herrscher über die Oper in Paris - ein Faktotum, das irgendwann genug von all den Noten hatte und sich zurückzog, um seiner zweiten Leidenschaft zu frönen: dem Kochen.
Wie ein guter Küchenchef hat Rossini auch komponiert: Ein bisschen hier, ein bisschen da - fertig war der Zaubertrank! Die berühmte Ouvertüre aus dem "Barbier von Sevilla" hat er zum Beispiel gleich zweifach recycelt. Sie steht am Anfang der Oper "Aureliano in Palmira", eröffnet das Singspiel "Elisabetta" und ist erst als Vorspiel zu der turbulenten Komödie um den spanischen Frisör zu einem Schlager der Musikgeschichte geworden. Dabei war das zunächst kaum abzusehen. Denn das Premierenpublikum ließ Rossinis musikalischer Kochtopf weitgehend kalt: dem Geiger rissen die Saiten, eine Katze trollte über die Bühne, die Zuschauer pfiffen und der Vorhang fiel frühzeitig.
"Sternstunden der Oper"
Die komplette, zehn DVDs umfassende Edition "Sternstunden der Oper" können Sie für 129 Euro im stern-Shop bestellen.
Inzwischen hat die Musikgeschichte ihr eigenes Urteil gefällt: "Der Barbier" gehört zu den beliebtesten Opern überhaupt. Und das liegt zum großen Teil an ihrer kongenialen Komik, an der Ernsthaftigkeit unter dem Humor, vor allen Dingen aber an Rossinis musikalischem Geschmack und Können.
Wie kein anderer wusste er, was das Publikum und vor allen Dingen die Sänger ersehnten: prestigeträchtige, virtuose Arien, einfallsreiche, große Ensembles und bombastische Zwischenmusiken. Eine Oper aus der Hand Rossinis ist wie ein rauschendes Klangfest, das kurzweilig von einem Höhepunkt zum nächsten rast.
Zuweilen absurd kalauernden Handlung
Im "Barbier von Sevilla" geht es um den gerissenen Haarschneider, der durch seine geschickten Tricks die Liebe zwischen Rosina und dem Grafen Almaviva einfädelt und ganz nebenbei den alten Don Bartolo düpiert, der das junge Mädchen am liebsten wegsperren will. Gerade in der zuweilen absurd kalauernden Handlung liegt das Genie Rossinis: Er gibt dem sich ewig wendenden Plot eine Musik, die jedes Wort zu einem Kunstwerk macht. Seine Klänge verstricken alle Charaktere zu einem großen, aufgeplusterten Interessensknäuel, in dem jeder mit jedem verknotet ist.
Dabei setzt Rossini auf eine überzeichnende musikalische Sprache, die sein Bühnenpersonal aussehen lässt, als würde es aus einem modernen Comic kommen: Sein Figaro bekommt eine eigene, eitle Auftrittsarie ("Figaro, Figaro!"), in der er selbst das Haarschneiden als philosophische Kunst behauptet und als psychologische Therapie für seine Kunden. Graf Almaviva tritt hauptsächlich auf, um schön zu singen. Und wenn Bartolos Berater, Don Basilio, eine Verleumdung plant, ist im Orchester zu hören, wie sich ein Gerücht vom leisen Flüsterton bis zum Donner von Kanonen aufschwingt. Rossinis Rosina ist nicht nur ein hübsches Mädchen, sondern eine Frau, die ihre Selbstbestimmung lernt und sich zur einfallsreichen Kämpferin für ihre Liebe mausert.
Große operale Gaudi mit Tiefgang
Der Stoff um den Figaro aus Sevilla ist prädestiniert, um latente gesellschaftliche Konflikte in Szene zu setzen: das Verhältnis von Männern zu Frauen, von Bediensteten zu Adeligen, von Mensch zu Mensch. Mozart hat das in seiner "Hochzeit des Figaro" (eigentlich die Folgegeschichte des später komponieren Rossini "Barbiers") vorgemacht. Für ihn war die Intrigen-Konstellation rund um den Figaro eine Versuchsanordnung, um die Mechanismen der Liebe und des Betrugs zu deklinieren. Rossini hat diesen musikhistorischen Staffelstab aufgenommen und auf seine Weise weitererzählt: als große operale Gaudi mit Tiefgang.
Bis heute sind die einzelnen Stücke seiner Oper eine Plattform für Sänger, um sich zu profilieren. Wenn man es dabei mit einer Sopranistin wie Cecilia Bartoli zu tun hat, die in dieser Aufnahme die Rosina singt, wird deutlich, dass Rossinis Koloraturen nicht bloße Dekoration sind, sondern eine subversive Bedeutung verbergen. Bartoli schafft es, mit ihrer Stimme dorthin vorzudringen, wo der Hobbykoch Rossini seine Opern am liebsten angesiedelt hat, irgendwo im leicht verdauenden Magen, gleich unter einem schwer klopfendem Herzen.