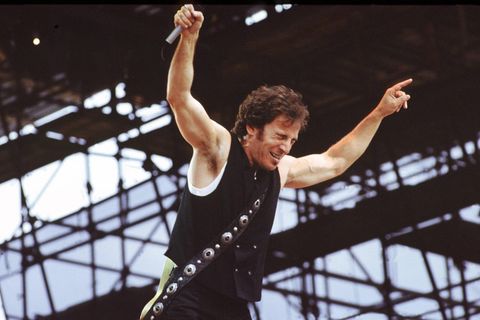Kein Witz: Ein Konsortium plante ernsthaft, aus Burg Hoheneck in Sachsen, dem gefürchtetsten Frauenzuchthaus der DDR, wo "Politische" wegen versuchter Republikflucht ebenso einsaßen wie Kindsmörderinnen und ehemalige KZ-Wächterinnen, ein "Event-Hotel" zu machen. Dort sollten die Gäste in zellengroßen Zimmern wohnen und Schließerinnen (genannt "Wachteln") morgens früh einzig einen Knust Brot als Frühstück servieren.
"Das haben wir verhindert", sagt Ellen Thiemann, Journalistin und Buchautorin, in den 70ern Insassin von Hoheneck, heute Mitglied im Hohenecker Frauenkreis, der alljährlich in schaudernder Erinnerung an frühere Zeiten zusammenkommt und noch einmal die Stätte des Schreckens gemeinsam abschreitet. Der Frauenkreis war auch für die Autorin Kristin Derfler eine der wichtigsten Informationsquellen, sowohl für ihre Dokumentation "Die Frauen von Hoheneck" sowie für den Film "Es ist nicht vorbei".
Beides hintereinander zeigt die ARD an diesem Mittwoch, dem Jahrestag des Mauerfalls. Die Dokumentation führt mit Zeugenaussagen in die Zeit von damals zurück. "Es ist nicht vorbei", von Franziska Meletzky inszeniert, blendet sich in das Danach ein: Ein weiblicher Häftling von damals, die Pianistin Carola, begegnet dem Arzt wieder, der sie einstmals im Zuchthaus mit Medikamenten "ruhig stellte", sie damit physisch und psychisch verstümmelte. Bis dahin hatte sie das Geschehen von damals weithin verdrängt.
Keine Ahnung von DDR-Schreckensstätten
Jetzt bricht wieder alles auf. Und sie will nur eines: dass dieser Mann zu seiner Schuld steht. Anja Kling spielt die Carola, Ulrich Noethen den selbstgerecht und unbeirrt seiner Arbeit nachgehenden Arzt. Zwischen ihnen steht Carolas Mann Jochen, der bald nicht mehr recht weiß, wem er glauben soll. Sein Darsteller Tobias Oertel sagt: "Ich kann die Irritation des Mannes verstehen. Er weiß wirklich nicht, woran er nun eigentlich ist." Seine grundsätzliche Erkenntnis aus diesem Film: "Um wie vieles leichter es Tätern als Opfern fällt, frühere Schuld zu verdrängen, als hätte sie nie stattgefunden."
Er ist im Westen aufgewachsen. Hauptdarstellerin und Regisseurin sind in der DDR groß geworden, hatten, wie beide beteuern, "eine schöne, behütete Kindheit." Von der Hohenecker Existenz wie von der anderer DDR-Schreckensstätten hatten sie keine Ahnung. Umso intensiver fühlten sie sich nun in diese Welt ein, deren Täter bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen wurden.
Anders als der Arzt im Film, der sich rasch noch eines Mordversuchs schuldig macht und so trotz Verjährung seiner alten Schuld in Handschellen abgeführt werden kann. Und dieses aufgesetzt wirkende, kräftig nach einem schlechten "Tatort" schmeckende Ende ist das entschieden Schwächste am sonst eindrucksvoll gelungenen Film. Die Autorin hebt dazu nur resignierend die Schultern. Auch sie hatte sich zunächst einen recht anderen Schluss gewünscht.
Die bei der Presse-Präsentation anwesenden Zeitzeuginnen Helga Riede und Ellen Thiemann waren dennoch tief erschüttert und hatten emotionale Mühe, dem Film zu folgen. Helga Riede: "Die ganze Zeit von damals kam wieder, als sei alles erst gestern gewesen." Und Ellen Thiemann sagt: "Wir waren zu ein paar Jahren verurteilt. Tatsächlich dauert unsere Haftzeit lebenslang."