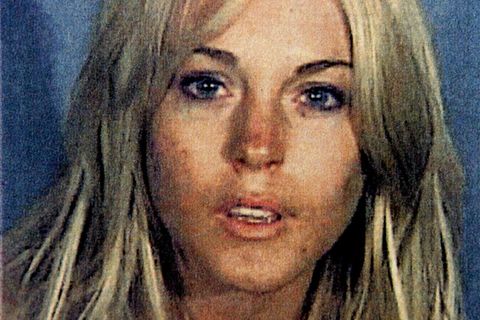"Warum schaust du mich nicht an, wenn ich mit dir spreche?" Oder: "Wo guckst du denn schon wieder hin?" Solche Vorwürfe hat jeder schon einmal zu hören bekommen. Der Angesprochene fühlt sich meist ertappt und reagiert betreten. Psychologen und Neurologen freuen sich dagegen darüber, dass die Augen wie kein anderes Sinnesorgan verraten, was im Kopf vorgeht: "Augenbewegungen sind ein direktes Maß dafür, womit sich der Geist gerade beschäftigt", sagt Hans-Otto Karnath, Neurologe an der Universität Tübingen. Anhand dieses Fensters in den Kopf wollen die Forscher ergründen, wie das Sehorgan in Sekundenbruchteilen eine Szene oder ein Wort erfasst. Es ist ein rasender Beobachter, der es mit den Details allerdings nicht immer so genau nimmt.
Selektive Wahrnehmung war von Vorteil
"Was unsere Aufmerksamkeit erlangt, kann einerseits die Augen steuern, aber auch das Gehirn", schildert Karnath. Wenn die Kaffeetasse angeschaut werden soll, befiehlt die Denkzentrale dies den Pupillen. Umgekehrt können auch die Augen das Gehirn auf ein Objekt aufmerksam machen, etwa ein Kind auf einem Dreirad, das am Rand des Blickfeldes auftaucht.
Für beide Strategien, die kopf- und die augengesteuerte Wahrnehmung, sind im Gehirn unterschiedliche Areale verantwortlich. Einzelne dieser Zentren können bei Schlaganfallpatienten zerstört sein: Sie können beispielsweise die Kaffeetasse nicht ansehen, auch wenn sie dies wollen. Andere sehen zwar das Kind auf dem Dreirad am Rand des Sichtfeldes. Dennoch ist es ihnen nicht möglich, die Pupillen gezielt hinzuwenden.
Damit der Blick immer wieder auf neue Gegenstände schweifen kann, ist folglich ein Netzwerk unterschiedlicher Regionen im Kopf nötig. Zudem müssen die Augen sich in Millisekunden in alle Richtungen bewegen können. Sie machen kurze Bewegungen, wenn man ein Buch liest, oder längere, wenn man die Landschaft während einer Zugfahrt beobachtet.
Allerdings erfasst das menschliche Auge eine Szene nur in einem winzigen Bereich in der Mitte des Blickfeldes scharf. Zum Rand hin läuft das Bild schemenhaft aus. "Diese selektive Wahrnehmung hat sich im Laufe der Evolution als vorteilhaft herausgebildet, da so die lebensnotwendige Information in der Bilderflut blitzschnell erfasst werden kann", sagt Karnath.
Bewegungen und hervorstechende Farben ziehen dabei den menschlichen Blick auf sich. "Wir sind immer auf der Jagd nach etwas Interessantem", betont Ralf Engbert, Physiker und Psychologe an der Universität in Potsdam. Die Sehforscher können mittlerweile sogar vorhersagen, welches Objekt in einem Bild als erstes betrachtet wird.
Der Kopf setzt seine eigene Szenerie zusammen
Eine züngelnde Schlange auf einem Wanderweg etwa nimmt das menschliche Sehorgan in Millisekunden in Beschlag. Sofort erteilt das Gehirn die Anweisung, dem Tier auszuweichen. Die Bäume am Wegesrand, der Bach in 50 Metern Entfernung, die moosbewachsenen Steine sind in diesem Augenblick Nebensache.
Fragt man die Wanderer später nach den Details der Umgebung, so können sie sich an diese nur lückenhaft erinnern. Die Lücken füllen sie jedoch unbewusst mit eigenen Erwartungen: Die Buchen verwandeln sich in den Schilderungen in Fichten, die Steine verschwinden aus dem Bild.
Aus den abgespeicherten Eindrücken setzt der Kopf seine eigene Szenerie zusammen. Dass diese mit der Wirklichkeit nur in Teilen zu tun hat, konnte Renate Volbert, Rechtspsychologin an der Charité Berlin, auch bei der Befragung von Zeugen feststellen: Sie beschreiben den Täter meist ungenau, verpassten ihm schon mal eine andere Haarfarbe oder setzten ihm eine Brille auf. Umgekehrt sahen sie beim Betrachten von Fahndungsfotos oft in unschuldigen Personen den Täter.
Textzeilen werden einfach ausgelassen
Ähnlich ungenau, dafür ebenfalls extrem schnell gehen die Augen beim Lesen vor: "Das Hervorstechendste ist, dass wir gar nicht jedes Wort erfassen, sondern vielleicht das erste, dritte und fünfte in einem Satz und anhand dessen den Rest einfach erraten", sagt Engbert.
Das Auslassen von Textteilen nimmt mit zunehmendem Alter zu. Aufgrund des größeren Wissensschatzes, vermutet Engbert, müssen dann noch weniger Wörter aufgenommen werden, um den übrigen Text im Geist zu ergänzen. Ergibt der erste Schnelldurchlauf Unsinniges, hüpfen die Augen Wort für Wort zurück und entschlüsseln die übersprungenen Begriffe. Im Schweinsgalopp schaffen die Augen so 400 Wörter pro Minute, wobei etwa die Hälfte unbesehen vom Gehirn ergänzt wird.
An besonders langen und seltenen Ausdrücken bleibt das Auge allerdings beim Lesen oft hängen. "Das Wort 'Bundeskanzlerin' wird bestimmt zwei- bis dreimal fixiert, bis es erfasst ist", erläutert Engbert. Texte mit vielen Fachausdrücken sind besonders mühsam zu lesen.
Die meiste Zeit beim Lesen entfällt jedoch darauf, dass die Augen überhaupt bewegt werden müssen. Studien haben ergeben, dass man fünfmal so schnell schmökern könnte, wenn die Pupillen starr blieben und die Worte in der Mitte eines Monitors eingeblendet würden. Für das Lesen dieses Textes waren übrigens rund 2000 Augenbewegungen nötig.