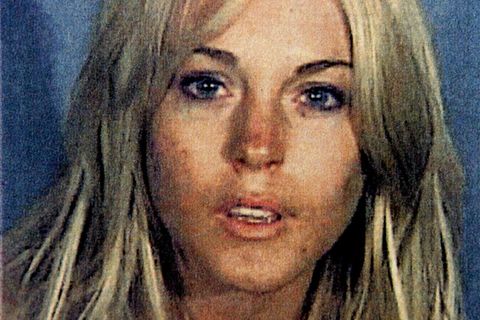Der Mensch besitzt 20.000 bis 25.000 Gene und damit deutlich weniger als die angenommenen 30.000 bis 40.000. Dies geht aus der nun weitgehend kompletten Version des menschlichen Erbguts hervor, die das internationale Humangenomprojekt (IHGSC) an diesem Donnerstag im britischen Fachjournal "Nature" (Bd. 431, S. 931) vorstellt. Die Zahl der chemischen Bausteine des Erbmoleküls DNA beziffert das Konsortium nun auf 3,08 Milliarden. Davon seien inzwischen 2,88 Milliarden (rund 93,5 Prozent) mit bislang unerreichter Genauigkeit in den frei zugänglichen Datenbanken des öffentlich finanzierten Genomprojektes gespeichert.
Auf der Spur der "Krankheitsgene"
Die gewaltige Datensammlung soll helfen, Erbanlagen für Krankheiten wie Krebs, Herzkreislaufleiden oder Diabetes zu identifizieren und diese gezielt zu bekämpfen. So sind bereits rund 1500 "Krankheitsgene" bekannt. An fast allen erblichen Krankheiten sind jedoch mehrere Gene beteiligt. Aufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte wird es sein, deren Zusammenspiel im Detail zu klären, um auf diese Weise neue Medikamente schaffen zu können.
Aus dem Vergleich des menschlichen Erbguts mit dem anderer Organismen möchten Genetiker weitere Erkenntnisse über den Ursprung bestimmter Krankheiten und neue Therapiemöglichkeiten gewinnen. So sind etwa Schimpansen, deren Erbgut dem des Menschen zu 98,8 Prozent gleicht, gegen Krankheiten wie Aids und Malaria gewappnet. Von der Entdeckung jener Erbanlagen, die Affen vor diesen Infektionen schützen, erhoffen sich Forscher Fingerzeige auf entsprechende Prävention beim Menschen. Außerdem sollen die Resultate die Entwicklung maßgeschneiderter Arzneimittel für den einzelnen Patienten ermöglichen, die wenige oder gar keine Nebenwirkungen haben.
Erste Genom-Versionen waren lücken- und fehlerhaft
Genetiker haben das menschliche Genom bereits mehrfach als "entziffert" bezeichnet. Besonders groß war die Aufmerksamkeit im Februar 2001, als sowohl das IHGSC als auch die privat finanzierte Konkurrenz, das US-Biotechnikunternehmen Celera, nach einem Wettrennen um die Sequenzdaten ihre "Arbeitsversionen" präsentierten. Diese enthielten jedoch noch viele Lücken und Ungenauigkeiten. Nur die steuerfinanzierten Genforscher haben ihre Resultate in den vergangenen rund dreieinhalb Jahren mit großem Aufwand komplettiert.
Die an Genen reichen und damit für fast alle Lebensprozesse besonders wichtigen Regionen sind den neuen Angaben zu Folge zu 99 Prozent komplett. Im Durchschnitt komme dabei auf 100.000 richtig gelesene Bausteine nur ein falscher.
"Der Schritt von der Rohfassung zur komplettierten Sequenz hat sich ausgezahlt", sagte Matthias Platzer, Leiter der Genomanalyse am Institut für Molekulare Biotechnologie in Jena. Er ist zugleich Koordinator für genomische Sequenzanalyse innerhalb des deutschen Humangenomprojektes. 58 Prozent der vor drei Jahren vorgestellten Gene hätten Fehler enthalten. Zudem sei nun klar, welches Gen auf welchem Chromosom liege. Im Jahr 2001 habe es zudem noch rund 150.000 Lücken im Genom gegeben. Diese Zahl ist nach den neuen Angaben auf 341 geschrumpft.
"33 von ihnen lassen sich mit den vorhandenen Methoden nicht lesen", sagte Platzer. Die übrigen 308 würden vermutlich zum Gegenstand gesonderter Forschungsprojekte. Ob es je eine eine "endgültige" Version der menschlichen Erbgutsequenz geben wird, ist fraglich, zumal sich auch die Genome von zwei Menschen um bis zu 0,1 Prozent voneinander unterscheiden.
DPA