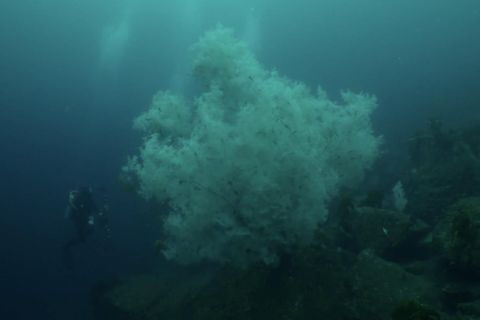Gern tut er's nicht. "Für die Tiere ist es wie ein Erdbeben", sagt Hubert Fleischmann, "viele gehen dabei drauf." Mit der bloßen Hand langt er in den wimmelnden Haufen, greift einen Teil davon und legt ihn in eine große Plastiktonne. Handvoll für Handvoll, Schicht für Schicht, bis der einen Meter hohe Ameisenhügel abgetragen ist. Dann graben sich Fleischmann und sein Helfer mit einer Schaufel noch ein gutes Stück in den Untergrund. Nach zwei Stunden ist alles - Tiere und Nestmaterial - in zwei Tonnen verschwunden, die beiden Verschwitzten sind mit Krabblern übersät, haben Hunderte Bisse und Ameisensäure-Spritzer abbekommen.
Die Fässer kommen auf einen Pkw-Anhänger und werden zum nahen Waldrand gefahren. Dort türmen die Männer, nachdem sie Zweige und Spezialfutter ausgelegt haben, den Inhalt sorgfältig auf. In den nächsten Wochen, Monaten und Jahren werden sie kontrollieren, ob ihre Aktion Erfolg hatte. "Wichtig ist, dass wir die Königin erwischt haben und dass sie heil geblieben ist", sagt Fleischmann.
Zwangsumsiedlung einer Kolonie der Wiesenwaldameise mit 300.000 bis 400.000 Tieren beim oberpfälzischen Städtchen Auerbach. Das Volk musste weichen, weil am alten Standort ein Haus gebaut werden soll. Für Fleischmann ist die Prozedur Routine, weit mehr als 1000-mal hat der Vorsitzende des "Arbeitskreises Notund Rettungsumsiedelung" der Deutschen Ameisenschutzwarte aus dem nahen Nabburg Insektenkollektive vor Baggern oder genervten Anwohnern in Sicherheit gebracht. Ehrenamtlich, in der Freizeit. "Ich bin ameisenverrückt", gesteht er. "Die Tiere faszinieren mich. Doch ihr Lebensraum schrumpft, und die vielerorts verwendeten Pflanzenschutzmittel setzen ihnen zu. Deshalb versuchen wir alles, um den Rückgang der Kolonien aufzuhalten."
Ungewöhnliche Geschöpfe
Nicht nur organisierte Heger mögen die Tierchen. Seit Jahrhunderten sind Naturforscher begeistert von den sechsbeinigen Winzlingen, die zu den ungewöhnlichsten Geschöpfen unseres Planeten gehören, weil sie in perfekt funktionierenden Staaten leben. Salvador Dalí montierte sie als riesige Skulpturen an seine Hauswand, Filmemacher und Kinderbuchautoren erzählen anrührende Ameisengeschichten. Spaziergänger sind hin und weg vom unergründlichen Treiben der Massen im Hügel am Wegesrand. Und für Wissenschaftler sind die Wesen mit dem dreigliedrigen Körper ein unerschöpfliches Forschungsthema. "Es gibt nicht die Ameise, sondern eine ungeheure Vielfalt mit immer wieder anderen Verhaltensweisen", sagt Jürgen Heinze, Professor für Biologie an der Universität Regensburg, "so geht uns der Stoff in den nächsten Jahrzehnten nicht aus."
Mehr als 16.000 verschiedene Spezies der Insektenfamilie Formicidae haben Zoologen bis heute identifiziert, und jedes Jahr entdecken sie neue. Die kleinsten messen knapp einen Millimeter, die größten drei Zentimeter. Fast überall auf dem Planeten wimmelt es von ihnen. Obwohl ein einzelnes Tier nur ein paar Milligramm wiegt, übersteigt die Biomasse der Winzlinge die der Menschen. "Sie wälzen weltweit mehr Erde um als die Regenwürmer", sagt Forscher Heinze.
Die Sechsbeiner sind unentbehrlich fürs Ökosystem. Viele heimische Arten halten als "Polizei des Waldes" Insektenarten in Schach, die sonst die Baumbestände niedermachen würden. Auch zahlreiche kleinere Wildpflanzen brauchen die Tierchen, die ihre Samen verschleppen und für deren Verbreitung sorgen. Darüber hinaus sind die Krabbler proteinreiche Leckerbissen für Vögel - und helfen den Gefiederten noch auf ganz andere Weise. Werden Lerche, Drossel oder Eichelhäher von Milben geplagt, fliegen sie zu einem Ameisenhügel und hocken sich mit ausgebreiteten Schwingen darauf. Dann versuchen die Aufgeschreckten, die Eindringlinge mit Säurespritzern abzuwehren, und töten dadurch die Parasiten.
Einzeln gehen sie zugrunde
So zahlreich und verschieden die Mitglieder der Formicidae-Familie auch sind - alle leben in Pulks; ein isoliertes Einzelwesen würde innerhalb von Tagen zugrunde gehen. Manchmal sind es nur kleine Verbände mit gerade mal einem Dutzend Mitgliedern, andere Spezies bilden Megagesellschaften mit Millionen Individuen. Vor wenigen Jahren entdeckten der Schweizer Ameisenforscher Laurent Keller und seine Mitarbeiter von der Universität Lausanne die bis heute größte bekannte Kolonie: Fast 6000 Kilometer lang erstreckt sie sich am Meer - von der italienischen Riviera bis an die spanische Atlantikküste. Ein Abermilliardenheer eingewanderter argentinischer Ameisen.
Die überwiegende Zahl der Arten ist sesshaft, baut Nester. Manche dieser Behausungen, etwa die der nur wenige Millimeter messenden heimischen Schmalbrustameisen, bestehen aus wenigen Gängen und sind so winzig, dass sie in eine Eichel oder einen Kirschkern passen. Andere Tiere, wie zum Beispiel die in Südasien lebenden Weberameisen, kleben in den Kronen von Bäumen Blätter zu einer Höhle zusammen - mithilfe von Fäden aus ihren Larven.
Die bei uns beheimatete Rote Waldameise errichtet meterhohe kuppelförmige Domizile mit Labyrinthen aus Hohlräumen sowie ausgeklügelten Belüftungs- und Klimaanlagen. Und selbst diese erstaunlichen Bauwerke wirken bescheiden gegen die Architektur der südamerikanischen Blattschneiderameise Atta sexdens. Ihr unterirdisches Zuhause, ein wahres Metropolis, besteht aus mehr als 1000 Kammern, verbunden durch ein kilometerlanges Röhrensystem. Ein Ringtunnel sowie eine Batterie kreisförmig angeordneter Entlüftungsschächte, die nach oben führen, perfektionieren den Bau.
Ameisen verblüffen Biologen
Nicht nur als Konstrukteure leisten die Wesen mit den Minigehirnen Großes. Sie entwickelten Überlebenstechniken, die selbst Biologen immer wieder verblüffen. So züchten einige Spezies in den Kammern ihres Nestes auf Beeten aus zerkleinerten Blättern und Speichel einen Pilz, dessen Knöllchen sie genüsslich vertilgen. Andere halten Läuse als "Melkkühe". Rund um die Uhr schützen sie die Tierchen vor Feinden, und wenn sie Hunger haben, trommeln sie mit ihren Fühlern auf deren Leiber, damit sie ihren zuckerhaltigen Kot abgeben - eine Leckerei. Sogar Sklavenhalter sind am Werk: Diese Sechsbeiner rauben aus artfremden Nestern Larven und Puppen, päppeln die fremde Brut und lassen die Geschlüpften für sich arbeiten.
Nichts jedoch beeindruckt mehr als der Zusammenschluss der Tiere zur Kolonie und das Funktionieren dieses Staates. Wie kann es im chaotischen Gewusel Abertausender Winzlinge überhaupt planvolles Handeln geben? Wer oder was steuert die unüberschaubare Kooperative? Und wie funktioniert die Verteilung der Aufgaben im Gefüge? Generationen von Forschern ließen diese Fragen nicht los, und manche Antwort haben sie heute parat.
In der Insektengemeinschaft dreht sich fast alles um die Königin. Sie ist in der Regel das einzige vermehrungsfähige Weibchen und größer als alle anderen Mitglieder der Kolonie. Die Völker mancher Spezies allerdings besitzen mehrere Exemplare ; bei einigen, etwa der heimischen Kahlrückigen Waldameise, können es gar Tausende sein.
Für 28 Jahre Königin
Bald schon, nachdem im Frühsommer eine geflügelte Jungkönigin geschlüpft ist, entschwebt sie zum Hochzeitsflug. Dabei begattet sie die ebenfalls geflügelten Ameisenmänner aus anderen Nestern. Die Spermien ihrer Freier lagert die Insektenfrau in einer "Samenbank" im Hinterleib, sie müssen für ihr restliches Leben reichen. Und das währt meist lang. "Den Rekord hält eine Königin der Schwarzen Waldameise", berichtet Laurent Keller von der Universität Lausanne, "sie lebte in einem Schweizer Labor und wurde 28 Jahre alt."
Nach der Rückkehr zur Erde stößt die Begattete ihre Schwingen ab, gräbt eine Höhle und beginnt, Eier zu legen. Jedenfalls bei vielen Arten. Bei anderen wird die Jungkönigin einfach adoptiert, in ein Nest der eigenen Spezies aufgenommen. Oder sie dringt in den Bau einer fremden Spezies ein, tötet deren Stammmutter und lässt das Volk ihre Brut aufziehen.
Wie immer die Kolonie gegründet wird: Die Königin ist eine Eierlegemaschine, produziert oft mehrere Hundert Eier täglich. Dabei werden solche, die sie nicht aus ihrem Spermavorrat befruchtet, zu Männchen. Denn ob ein Nachkomme männlich oder weiblich wird, hängt bei Ameisen lediglich davon ab, ob der Chromosomensatz im Ei einfach oder doppelt ist. Nur bis zu ein paar Tausend Männchen sind nötig fürs Volk. Wenn sie, wenige Wochen alt, im Sommer zum Hochzeitsflug ausschwärmen, ist ihr Dasein besiegelt. Danach sterben die Ameisenmänner innerhalb von Stunden.
Arbeiterinnen leben deutlich kürzer
Aus befruchteten Eiern werden Weibchen mit zurückgebildeten Geschlechtsorganen. Sie gehören in großer Zahl zum Pulk, es sind die Arbeiterinnen. Lebensdauer: nur ein bis drei Jahre. Folglich müssen immer wieder Nachfolgerinnen erbrütet werden. Die Horde der Ameisenfrauen erledigt eine Fülle von Jobs, ihre Arbeitsteilung ist perfekt.
Da gibt es beispielsweise den Außendienst. "Nahrungsbeschafferinnen" schwärmen vom Bau aus und sammeln oder erbeuten Fressbares, auf "Straßen", die mit Duftstoffen markiert sind und auf denen sie selbst bei größtem Andrang staufrei flitzen können. "Materialbeschafferinnen" wiederum klauben Holzstückchen und anderes zusammen, mit dem "Nestbauerinnen" das Ameisenheim ausstaffieren. Zudem sind "Energiesammlerinnen" aktiv, sie heizen sich in der Sonne auf und bringen die Wärme ins Heim. Den Eingang zur Ameisen-WG kontrollieren "Wächterinnen", sie erschnuppern, ob der Geruch des Ankommenden stimmt. Wenn nicht, schlagen sie den Eindringling in die Flucht, mit Bissen und Ameisensäure oder - je nach Art - mit Stachel und Gift.
Jedes Tier hat seine Aufgabe
Im Innendienst malochen "Reinigungskräfte", sie entfernen Abfall und die Leichen von Artgenossen. "Lagerarbeiterinnen" zerkleinern und verstauen die angelieferte Nahrung. Andere Tiere wiederum bilden lebende "Futterspeicher", werden so sehr mit Fressbarem vollgestopft, dass sie getragen werden müssen, weil ihre Beinchen nicht mehr auf den Boden reichen. In schlechten Zeiten würgen die Gemästeten dann alles wieder raus. "Brutpflegerinnen" schleppen Eier, Larven und Puppen und füttern den Nachwuchs. Und der "Hofstaat" kümmert sich um die Königin, nimmt frisches Gelege in Empfang, pflegt und ernährt die erste Dame des Staates. Dabei kommt das Fressen für die Stammmutter aus Drüsensekreten dieser Arbeiterinnen, als besonderes Kraftfutter reichen sie es von Mund zu Mund. Die Spezialnahrung findet auch bei der Aufzucht von Jungköniginnen Verwendung. Damit aus einem befruchteten Ei jedoch eine neue Königin und keine Arbeiterin wird, bedarf es noch einer ganzen Reihe weiterer Faktoren, etwa der richtigen Temperatur und spezifischer Duftsignale vom Muttertier - längst nicht alle sind bei den verschiedenen Arten bekannt.
Verwirrende Jobvielfalt, Aufgaben ohne Ende. Doch woher weiß das Ameisenindividuum, dass es genau diese Tätigkeit und keine andere zu erledigen hat?
Zu einem Großteil, so haben Wissenschaftler herausgefunden, steuern die Gene - und das auf vielerlei Art. So entstehen, vor allem wenn die Königin von mehreren Männchen befruchtet wurde, anatomische Variationen unter den Arbeiterinnen, die sie für gewisse Aufgaben prädestinieren. "Zudem läuft im Erbgut vieler Ameisen ein Programm ab, das dem Tier in gewissen Situationen sagt, was zu tun ist", erklärt der Regensburger Forscher Jürgen Heinze. "Bei einigen Arten ist es etwa als Jungtier auf Innendienst und als älteres auf Außendienst programmiert." Darüber hinaus besitzen die Insekten für die Verständigung im Team ein ganzes Arsenal von Duftstoffen, die sie in ihren Drüsen am Leib produzieren, und ein Antennenpaar, mit dem sie diese Pheromone wahrnehmen können. Damit treffen sie allerlei "Absprachen". Und regeln noch mehr. "Offenbar sondern manche Berufsgruppen gewisse Duftstoffe ab, die verhindern, dass sie weiteren Zulauf bekommen", sagt Heinze. Im Detail sind es hochkomplexe Abläufe - und noch lange sind nicht sämtliche Feinheiten enträtselt.
Es gibt auch Konflikte
Immerhin räumt moderne Ameisenforschung auf mit einer Idealisierung und Verklärung des Insektenstaates. Dem Volksglauben und manchem Schulbuch zufolge nämlich herrschen in einer Kolonie nichts als Fürsorge und Loyalität. Doch mitnichten ist das so. "Es gibt dort jede Menge Konflikte", berichtet Experte Heinze, "da wird überwacht, manipuliert und bestraft."
Er und seine Kollegen entdeckten, dass bei vielen Arten zwischen Königin und Arbeiterinnen ein erbitterter Konkurrenzkampf toben kann. Meist gelingt es der Stammmutter, mit speziellen Duftsignalen die Entwicklung von Eierstöcken bei den anderen Weibchen zu unterdrücken. Doch nicht immer. Dann legen auch diese Ameisenfrauen Eier. Häufig werden die von der Königin gefressen, gelegentlich jedoch entwickeln sich auch daraus Nachkommen, weil die Eier unbefruchtet sind, können allerdings nur Männchen entstehen.
Und bei den tropischen Arten der Gattung Cardiocondyla leben zweierlei Männer, die sich mit einer Jungkönigin im Nest paaren wollen: ungeflügelte aggressive sowie geflügelte friedfertige. Die ungeflügelten schalten alle Konkurrenten aus, massakrieren sie mit ihren säbelförmigen Kieferzangen. Um diesem Gemetzel zu entkommen, tarnen sich die geflügelten mit den Duftstoffen der jungen Königinnen. Die Folge: Anstatt sie anzugreifen, versuchen die Kämpfertypen sie zu begatten.
Transvestiten? Schwule Ameisen? Die Erforschung der Krabbler-Staaten wird noch Erstaunliches zutage fördern.