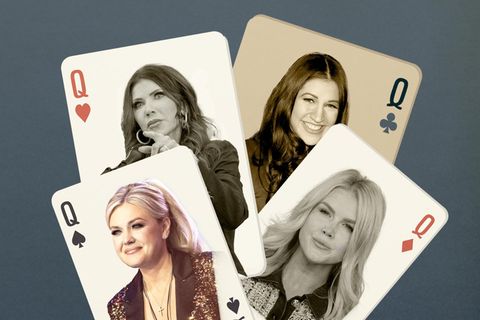Das EU-Betrugsbekämpfungsamt Olaf unter seinem deutschen Chef Brüner hält geheim, welche Briefe es mit der Bundesregierung austauscht. Diese Geheimhaltung ist unzulässig. Sagt jetzt der EU-Ombudsmann. Ombudsmann Nikiforos Diamandouros hat eben einen Empfehlungsentwurf veröffentlicht, wonach Olaf mir zu Unrecht bestimmte Informationen verweigert.
Anfang 2005 hatte ich von von dem Anti-Korruptionsamt Listen der Schreiben erbeten, die die Behörde von 2000 bis 2004 mit der Bundesregierung oder deutschen Bundesländern ausgetauscht hatte. Ich berief mich auf die EU-Verordnung über den Dokumentenzugang, die die EU-Behörden eigentlich verpflichtet, im Internet Register ALLER Dokumente zu veröffentlichen. Wohl gemerkt: Nicht die Dokumente müssen alle veröffentlicht, sondern nur ihre Existenz erwähnt werden. Auch von Dokumenten, auf die Bürger keinen Zugriff bekommen können. Nur besonders sensitive Dokumente dürfen - so sagt es die Verordnung - davon ausgenommen werden im Register genannt zu werden.
Olaf lehnte trotzdem ab. Die Erstellung einer Liste der gesamten Korrespondenz mit deutschen Bundes- und Landesbehörden wäre zu viel Arbeit, ließ Direktor Franz-Hermann Brüner erklären. Dass es eine Pflicht gebe, Dokumente in einem Register aufzuführen, sei ihm nicht bekannt. Mit dem Buchstaben des Gesetzes setzte er sich freilich nicht im Detail auseinander und ging nicht auf die Frage ein, warum die Verordnung eigentlich ausdrücklich Ausnahmen von der Registerpflicht vorsieht, wenn es diese gar nicht gibt.
Das hat auch den Ombudsmann gewundert. Und er vermisste "überzeugende Argumente", warum die Erstellung der von mir gewünschten Liste so furchtbar viel Arbeit machen würde.
Warum Olaf-Direktor Brüner das Licht so sehr scheut, darüber kann man nur spekulieren. Man kann sich daran erinnern, dass sich Ende 2005 und Anfang 2006 die Bundesregierung und angeblich auch "mehrere Ministerpräsidenten aus Süddeutschland" (Rheinischer Merkur) massiv für seine Wiederwahl einsetzten, obwohl ihnen bekannt war, dass Brüner im Kampf gegen den Betrug nicht gerade erfolgreich war.
Man kann sich auch daran erinnern, wie Brüner deutsche Firmen behandelte, wenn die in mögliche Betrugsfälle verwickelt waren. Zum Beispiel die Firma Siemens, gegen die Olaf jedenfalls nicht mit maximaler Schärfe vorging, als das Unternehmen in den Verdacht geriet, einen EU-Mitarbeiter mit einem Jaguar bestochen zu haben. Oder zum Beispiel die Firma Bayernland. Gegen sie gab es den Vorwurf (den das Unternehmen zurückweist), gepanschte Mafia-Butter aus Italien importiert zu haben.
Im Dezember 2000 hatte der stern publik gemacht, was Olaf vorher vernebelt hatte: dass die Panschbutter auch nach Deutschland gegangen sein soll.
Prompt ließ Brüner die Gesundheitsgefahren herunterspielen. Die Mitglieder des Olaf-Überwachungsausschusses waren darüber erstaunt. Welche Kompetenz habe denn Olaf in Gesundheitsfragen, wollten sie im September 2001 von Brüner wissen. Der argumentierte laut Protokoll, er habe das "Risiko" gesehen, dass "auf dem deutschen Markt" ein Problem für die Hersteller von "traditionellem Gebäck" auftrete, wenn der Verdacht weiter diskutiert werde, dass in den Weihnachtsplätzchen Panschbutter steckt.
Brüner hatte "nach Rücksprache" mit den betroffenen Mitgliedsstaaten interveniert. Sagte er laut Protokoll. Zumindest der Freistaat Bayern hatte ein leicht nachvollziehbares Interesse an "Bayernland". Denn dessen Vorstandsvorsitzender war und ist der Politiker Albert Deß. Von der CSU. Früher war er im Bundestag, heute ist er im Europaparlament (EP).
So wie das Betrugsbekämpfungsamt boykottiert übrigens die ganze EU-Kommission (anders als Ministerrat und Europaparlament) bis heute die Pflicht, ein einigermaßen vollständiges Register ihrer Dokumente zu veröffentlichen. Die Pflicht gilt seit 2002. Seitdem verspricht die EU-Exekutive, "schrittweise" ihre Online-Liste zu erweitern. Stattdessen hat die jetzige Kommission unter Präsident Barroso und Vize-Präsidentin Wallström den Umfang der Transparenz eingeschränkt - indem zum Beispiel die Korrespondenz des Präsidenten nicht mehr publik gemacht wird. Hat nix zu tun mit der "Transparenz-Initiativ" von Margot Wallström. Die betrifft Daten, die andere geheim halten...