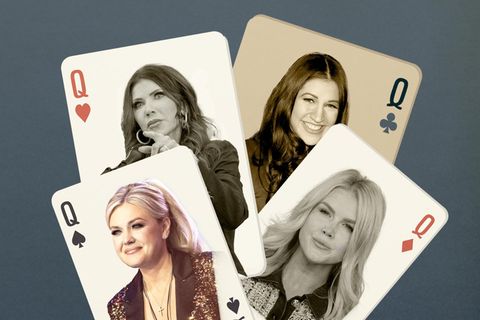Wäre die Europäische Union demokratisch organisiert und gäbe es ein EU-Parlament, das den Name verdient – dann...
... ja dann hätte die Opposition in dieser europäischen Volksvertretung schon längst einen Untersuchungsausschuss durchgesetzt.
Die bis heute ungeklärten Fragen liegen ja auf der Hand: Warum führten uns Kommission und Mitgliedsstaaten trotz vieler Warnungen in eine Währungsunion, der es am nötigen politischen Fundament fehlte? Warum empfahl die EU-Kommission die Aufnahme eines Staates wie Griechenland in die Euro-Zone? Übrigens am Ende zum Nachteil sowohl Griechenlands wie der anderen Mitglieder.
Und warum ignorierte die EU-Bürokratie kurz vor dem Beitritt der Griechen Hinweise der Statistikbehörde Eurostat, dass die Griechen ihre Statistiken schönten (wie wir gestern im stern enthüllten)?
Warum schließlich schaute die Kommission in den darauf folgenden Jahren tatenlos zu, wie sich die Ungleichgewichte innerhalb der Euro-Zone immer weiter aufschaukelten, mit wachsender Wettbewerbsfähigkeit im Norden und galoppierender Ausgabenfreude im Süden? Die Probleme waren in den zuständigen Dienstellen der EU-Bürokratie jedenfalls seit Jahren bekannt; man diskutierte über sie schon vor sechs Jahren in umfangreichen Berichten. Aber man entschied sich, sie nicht an die große Glocke zu hängen - übrigens auch unter der Leitung des deutschen Spitzenbeamten Klaus Regling, der heute den Rettungsschirm EFSF anführt. Immerhin räumte er inzwischen in einem Interview mit der "Zeit" ein, dass „eine breitere wirtschaftspolitische Überwachung“ der Wettbewerbsfähigkeit, von „Blasen am Immobilienmarkt und Leistungsbilanzen“ besser gewesen wäre.
Sollte der Euro in den kommenden Monaten oder Jahren doch noch kollabieren, wird das zu unser aller Schaden sein. Und spätestens dann wird sich der Blick nach Brüssel richten müssen. Dort hätte man das größte Interesse gehabt, das Prestigeprojekt Währungsunion zum Erfolg zu führen. Und zugleich hat man in der EU-Kommission mit am hartnäckigsten weggeguckt. Weil es nicht ins Bild passte, dass der Euro die europäischen Volkswirtschaften nicht in Gleichklang brachte, sondern sie auseinander trieb.
Bis heute glaubt man in der Brüsseler Bürokratie kritische Fragen einfach wegdrücken zu können. Für eine Recherche über die Aufnahme Griechenlands, die in unseren gestrigen Artikel mündete, hatte ich bereits Anfang November 2011 Einsicht in die Akten mehrerer Kommissionsdienststellen beantragt. Das Recht der Bürger auf Zugang zu Unterlagen ist in Brüssel eigentlich – seit einer von der schwedischen Regierung 2001 im Ministerrat durchgesetzten Verordnung - älter und besser verankert als in Deutschland. Dennoch reagierte auf meine Anfrage zu Griechenland und dem Euro einzig die Statistikbehörde Eurostat leidlich kooperativ – obwohl ich über sie in früheren Jahren auch viel Kritisches geschrieben habe.
Das dem Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso unterstehende Generalsekretariat der Kommission hingegen vertröstete mich Ende November zunächst, man würde „spätestens“ bis zum 29. Februar antworten. Seitdem herrscht dort – trotz mehrerer Beschwerden – absolute Funkstille. Noch kurioser die Reaktion der Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen (im Brüsseler Jargon: DG Ecfin), also genau der Kommissionsbehörde, die für die Währungsunion zuständig ist. Die dortigen Beamten übermittelten mir zwar Mitte Februar einige interne Unterlagen. Doch die betrafen ausschließlich die Zeit NACH Griechenlands Aufnahme in die Euro-Zone. Obwohl ich ausdrücklich um Akten aus der Zeit VOR der Aufnahme gebeten hatte.
Nur eine Leseschwäche - neben der bereits bekannten Rechenschwäche? Oder nicht doch ein Indiz, dass es etwas zu verbergen gibt? Zum Beispiel die Tatsache, dass man in der DG Ecfin von vornherein wusste, dass die griechischen Zahlen nicht stimmen konnten?
Weil ich mich damit nicht zufrieden gab, rückte die DG Ecfin im Mai einige wenige Papiere aus dem Frühjahr 2000 raus, also aus der Zeit kurz vor dem grünen Licht für Griechenland. Dennoch habe ich mich inzwischen mit einer formellen Beschwerde an den für solche Fälle zuständigen EU-Ombudsmann Nikiforos Diamandouros gewandt. Übrigens ein Grieche mit einem in der EU-Bürokratie ungewöhnlich tadellosen Ruf.
Die Kollegen von der Nachrichtenagentur Bloomberg machten ganz ähnliche Erfahrungen wie ich. Sie hatten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) Einsicht in Prüfpapiere über griechische Swap-Geschäfte erbeten, mit denen Athen wohl das Staatsdefizit verschleiern wollte. Auch Bloomberg lief gegen Wände und hat deshalb jetzt den Europäischen Gerichtshof angerufen. Der damalige EZB-Präsident Jean-Claude Trichet lehnte die Anträge der Kollegen Ende 2010 nämlich mit der bemerkenswerten Begründung ab, eine Freigabe der Unterlagen könnte das „öffentliche Vertrauen“ in die Wirtschaftspolitik gefährden und die „Instabilität“ der Finanzmärkte erhöhen.
Noch weniger Vertrauen? Noch mehr Instabilität? Wegen ein paar internen Papieren? Sollte das wirklich möglich sein?
Der Euro – er scheint eine Währung zu sein, die Transparenz nur schlecht verträgt.