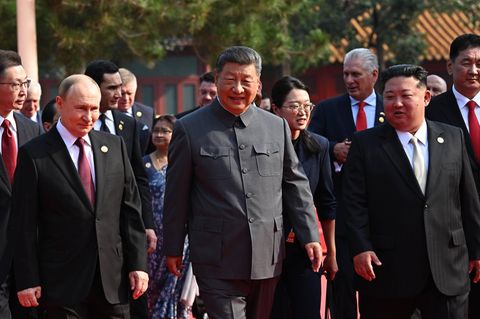Bei manchen Langstreckenrennen geschieht es, dass ein Läufer übers Ziel hinausschießt und unbeirrbar weiterrennt. So tief ist er in die Trance der Bewegung versunken und in das Durchstehen seines Kampfes, dass er weder die Glocke zur letzten Runde hört noch die Rufe der Rennrichter.
In einem ähnlichen Zustand befindet sich offenbar Herr Wei-de Sun. Er war der leitende Pressesprecher der Olympischen Spiele, und obgleich die nun seit drei Wochen vorbei sind, ist der Mann noch immer auf 180. Er feuert seine Sätze ab wie Salven, gespickt mit Zahlen, Namen, Statements. Vermutlich ist es ziemlich anstrengend, auf alles eine Antwort wissen zu müssen.
Der Mann hat eben Stress, würde man bei uns diagnostizieren. Und genau das fällt daran auf. Denn Stress gehört eigentlich nicht zur chinesischen Lebenswelt. Ich weiß das, weil ich nach einem weltweit verbreiteten, hochoffiziellen und nicht sonderlich plausiblen Lehrbuch Chinesisch lerne. Dort entspinnt sich bereits in der zweiten Lektion folgender Dialog: Ni mang ma? - Wo bu mang. Hast du viel zu tun? - Nein, ich hab' nicht viel zu tun. Dieser Satz wäre in einem deutschen Lehrbuch undenkbar.
Wo ist das Formblatt für unangemeldete Fragen?
Herr Sun aber hat kraft seines Amtes viel Kontakt mit westlichen Journalisten gehabt. Zu viel vermutlich, denn die machen ständig Stress, die können kaum mehr anders. Und das muss sich auf ihn übertragen haben. Irgendwie ist er gar kein richtiger Chinese mehr. So wie ja auch Pressesprecher kein richtiger chinesischer Beruf ist - bisher reichten Dekrete, Verlautbarungen und stillschweigende Übereinkünfte. Dass Informationen zwischen Obrigkeit und Öffentlichkeit hin- und herwandern, in beide Richtungen, das ist neu. Wo ist das Formblatt für unangemeldete Fragen?
Über den Autor
Aus Peking berichtet: Stefan Schomann, geboren 1962, freier Autor und Reporter, lebt in Berlin und Peking. Zuletzt erschien sein Buch "Letzte Zuflucht Schanghai" im Heyne Verlag, eine wahre Geschichte aus den vierziger Jahren, über die Liebe zwischen einem jungen jüdischen Emigranten und einer Chinesin aus gutem Hause.
Mehr über ihn unter www.stefanschomann.de
Meine paar Fragen freilich bringen Herrn Sun zunächst nicht weiter in Verlegenheit. Die Zukunft der olympischen Stätten - das hat er parat. Glorreich natürlich. Alles durchdacht, alles auf dem neuesten Stand. Multifunktional, international, bilateral. Die Zäune kommen weg, dann stehen die Hallen offen für Touristen, Sportler und Studenten. Wann? Demnächst. Wann genau? Sehr bald schon. Die Fechthalle? Wird Kongresszentrum. Das Pressezentrum? Wird auch Kongresszentrum. Doch, Peking kann das gebrauchen. Sehr bald schon. Alles durchdacht, alles auf dem neuesten Stand. Das olympische Dorf? Schon verkauft! Der Namensgeber für das Schwimmstadion? Noch geheim. Der für das Olympiastadion? Noch offen. Weitere Fragen?
Nur eine noch. Doch die bringt ihn prompt aus dem Konzept. Denn es ist eine emphatische Frage, vermutlich will ich ihn beruhigen, wo er doch so getrieben wirkt. Ob es während der Olympischen Spiele einen Ort gegeben hätte, der ihm persönlich ans Herz gewachsen wäre? Er stutzt, kommt aus dem Tritt. Na ja, füge ich an, meine Kolumne sei mit "Peking privat" überschrieben, doch bisher wäre noch gar nicht viel Privates darin zur Sprache gekommen. Herr Sun sucht immer noch nach einem Ausweg. Nein, meldet er schließlich, also etwas Derartiges, etwas wirklich Persönliches, so etwas hätte er nicht zu berichten.
Darin scheint er nun doch wieder ganz Chinese. Sein Innerstes bloßzulegen, entspricht so gar nicht den hiesigen Gepflogenheiten - diese ganze therapeutische Selbstreflektion ist ein rein abendländisches Hobby. Auch die Figuren in meinem Lehrbuch geben wenig von sich preis, und das, obwohl etliche davon sogar Ausländer sind. Doch wahrscheinlich assimilieren sie sich bereits. Und natürlich ist es erst einmal wichtiger, den Weg zum Bahnhof erfragen oder das Wechselgeld mitzuzählen zu können, als die Labyrinthe der Seele zu erkunden.
Wie die Spiele internationalisieren
Dann erzähle ich Herrn Sun eben etwas Persönliches, vielleicht tut es ihm gut: Ich bin in München aufgewachsen, in Sicht- und manchmal sogar Hörweite des Olympiastadions. Zusammen mit der folgenden Fußballweltmeisterschaft waren die Olympischen Spiele das große Spektakel meiner Kindheit, und was davon blieb, hat meine Jugend bereichert.
Der weitläufige Olympiapark war mein Abenteuerspielplatz. Für das Schwimmstadion hatte ich eine Dauerkarte, in anderen Arenen habe ich gelegentlich Wettbewerbe besucht, bin in der späteren Hochschulsportanlage sogar selber mal mitgerannt. Das Allzweck-Oval der Olympiahalle war nicht das schlechteste Kulturzentrum. Jimmy Page etwa, der in Peking zum Abschluss die musikalische Brücke nach London schlug, habe ich dort mit Led Zeppelin spielen gehört. Da waren wir freilich beide dreißig Jahre jünger.
Die Olympischen Spiele haben München unwiderruflich modernisiert und internationalisiert. Aus dieser Zeit stammt auch der Slogan von der "Weltstadt mit Herz" - was abermals zeigt, dass Gefühle im Westen mehr zählen als der Verstand, sonst hätte es ja geheißen "Weltstadt mit Hirn".
Etwas in der Art, Herr Sun, das mögen wir Journalisten. Wir können uns ja in 30 Jahren nochmal unterhalten. Wenn sich alles wieder etwas beruhigt hat.