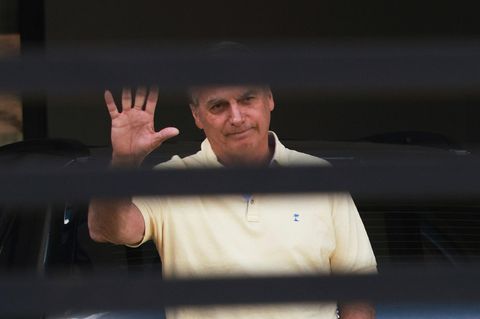Es sind Szenen wie im Krieg. Da, wo einst der Kindergarten stand, türmen sich nun Hügel aus zertrümmerten Backsteinen. Da, wo gerade noch Babys schliefen, klettern Kleinkinder über Scherben und zerborstene Betonpfähle. Da, wo ihr großer Traum Realität wurde – eine Kita für die ärmsten Familien der Favela – ist nichts geblieben als eine Ruine aus Schutt und Blech.
"Wie grausam müssen Menschen sein, die einen Kindergarten zerstören?", fragt die Leiterin, Maria do Carmo Souza, genannt Dona Carmen. Um sie herum stehen fassungslos Frauen und Kinder und suchen in den Trümmern nach Spielzeug. In der Luft hängt der Gestank von Kerosin und Benzin. Es ist Februar, ein heißer Tag in Menino Chorão, einem von Frauen gegründeten Armenviertel zwischen Autobahn und Flughafen in Brasiliens Bundesstaat São Paulo.
"Sie sagten: Wir wollen Carmens Kopf"
"Im März sollten der Kindergarten und die Bibliothek feierlich eröffnet werden", sagt Dona Carmen, 51, mit Tränen der Wut in den Augen. Ihr Kleid ist zerschlissen, das Haar zerzaust. Der Überfall hat die Anführerin der Frauenfavela, über die der stern vor sieben Jahren zum ersten Mal berichtete, furchtbar erschüttert. "Das ist der Psychokrieg der Männer. Mir selbst drohen sie mit dem Tod", sagt sie und blickt andeutungsvoll Richtung Nachbarviertel, das von der Drogenmafia kontrolliert wird.
"Das haben sie mir ausgerichtet", fällt Maria Silva ein, eine kleine stämmige Frau mit zurückgebundenen schwarzen Haaren. "Sie sagten: Wir wollen Carmens Kopf."
"Sie glauben, wenn sie Carmen beseitigen, bricht hier alles weg und sie erobern unsere Frauenfavela", ergänzt Regina Santos, eine hagere Mutter von fünf Kindern.
"So ist das in Bolsonaros Brasilien. Die Mächtigen nehmen sich, was sie wollen"
Wenn man die Frauen fragt, wer die Männer sind, blicken sie sich verschüchtert an. Schließlich ergreift Dona Carmen das Wort: "Alle. Der Chef der Drogenmafia hat Polizisten für die Aktion angeheuert. Er hat zudem enge Verbindungen zu Lokalpolitikern. Die wiederum arbeiten mit der Miliz zusammen. Sie stecken alle unter einer Decke. So ist das in Bolsonaros Brasilien. Die Mächtigen nehmen sich, was sie wollen. Aber wir geben nicht auf."
Ende des Jahres 2021 spitzte sich die Lage in Menino Chorão erstmals zu. Da verübten Mitglieder der Drogengang einen Brandanschlag auf Carmens Frauenzentrum "Oficina Cultural da Mulher", einer Mischung aus Suppenküche, Frauenhaus und Ausbildungszentrum. Sie brannten die Gemüsefelder und Obstplantagen nieder und hinterließen explizite Morddrohungen für Dona Carmen.
Die Betreiberin des Frauenzentrums musste in ein Frauenhaus fliehen
Am 18. Dezember dann veranstalteten Polizisten eine Razzia, als die Frauen gerade das kollektive Weihnachtsfest vorbereiteten. Zwölf Polizisten durchkämmten das Zentrum und setzten die Frauen fest. Dona Carmen, die um ihr Leben fürchtete, gelang die Flucht durch Maisfelder, zunächst über die Autobahn und dann in ein Frauenhaus in der nahegelegenen Großstadt Campinas.
"Sie waren darauf aus, Carmen Drogenhandel anzudichten", sagt Maria Silva. "Völlig absurd. Dann beschlagnahmten sie den Computer, Handys, Geld, es war eine Art Raubüberfall." Ein paar Tage später machten sie im Morgengrauen den neu gebauten Kindergarten mit einem Bulldozer platt.
"Der Grund für die Angriffe ist offensichtlich", sagt Paulo Mariante, ein versierter, stadtbekannter Rechtsanwalt, der die Verteidigung der Frauen übernommen hat. "Menino Chorão ist wie das unbeugsame gallische Dorf, falls Sie das kennen. Und Carmen ist die Jeanne d’Arc der Favela."
Die Mächtigen sind scharf auf das Land
Sie sei den Männern schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Erstens, weil sie sich das Patriarchat vorknöpfe und eine Art Selbstverteidigungsarmee gegen Männergewalt geschaffen hat. Zweitens, weil die Mächtigen scharf auf das Land seien, auf dem die Frauen vor 15 Jahren ihre "comunidade feminista" aus Backsteinhütten errichtet haben. "Jahrelang hatte das Land brach gelegen, bis die Frauen es als Teil der Landlosen-Bewegung "Sem-Teto" besetzten und vor Gericht Recht behielten. Jetzt, da Grundstückspreise hochgehen, wollen die Mächtigen es erobern und mit Profit verkaufen", sagt Mariante. "Wenn sie vor Gericht scheitern, nehmen sie das Recht in die eigene Hand und veranstalten Psychokriege." Das sei schon immer so gewesen, nicht erst seit Bolsonaro. "Aber es ist schlimmer geworden."
Seit der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro vor drei Jahren an die Macht kam, nehmen Gewalt und Willkür der Autoritäten zu. Polizisten verüben Massaker in Favelas, wie 2021 in Jacarezinho, als 28 Menschen erschossen wurden, vor allem Schwarze. Goldgräber und Holzfäller dringen zu Tausenden mit dem Segen des Präsidenten in den Regenwald des Amazonasbeckens ein und vergiften das Wasser mit Quecksilber, wie im Reservat der Yanomani. Der Präsident selbst hat Waffenverbote aufgehoben, wodurch allein 2021 mehr als 200.000 neue Schusswaffen in Umlauf kamen, 300 Prozent mehr als zum Zeitpunkt seiner Machtübernahme.
"Meine Spezialität ist das Killen", brüstet sich Bolsonaro gern. "Ich bin Hauptmann der Armee."
Bolsonaro erinnert an den Wilden Westen
Noch nie wurden so viele Umweltschützer, Journalisten, Indigene, Frauenaktivistinnen bedroht, gegen die der selbsterklärte Macho Bolsonaro mit Vorliebe hetzt. In diesen Tagen will er große Teile indigener Reservate für die industrielle Nutzung öffnen, fernab der Weltöffentlichkeit. Der Krieg in der Ukraine sei dafür "eine günstige Gelegenheit", wie er unverhohlen sagt.
In vielerlei Hinsicht erinnert Brasiliens Bolsonaro an den alten Wilden Westen: Nehmt euch, was ihr kriegen könnt. Der Stärkste siegt. Beseitigt die Schwachen.
Was empfiehlt der Anwalt Mariante Dona Carmen? "Untertauchen, zumindest nachts", antwortet er. "Viele andere Aktivisten in ihrer Situation wurden ermordet."
Andere Armenviertel übernahmen ihr Modell feministischer Selbstverteidigung
Eigentlich dachte Dona Carmen, alles im Leben schon mal erlitten zu haben. Aufgewachsen in bitterer Armut, verlor sie früh drei ihrer sieben Kinder. 13 Jahre lang ertrug die Analphabetin die Gewalt ihres Mannes, bis sie vor ihm aus Fortaleza in die Millionenstadt São Paulo flüchtete, 3000 Kilometer entfernt. Sie lebte auf der Straße, schlug sich mit Sexarbeit durch, bevor sie mit 40 ihre Bestimmung fand als Anführerin der Gemeinschaft landloser Frauen. Wenn deren Männer gewalttätig werden, stellt sich die selbsternannte "Kriegerin" ihnen mit einer Armee von Frauen in den Weg, im Notfall auch mit Knüppeln und Dolchen, und verordnet den Tätern Hausarrest und Sexentzug. Dona Carmen war so erfolgreich, dass andere Armenviertel ihr Modell feministischer Selbstverteidigung übernahmen.
Doch gegen Morddrohungen ist auch sie nicht gefeit.
Nach einigen Tagen in einem Versteck kehrt Dona Carmen zurück in ihr Viertel. Auf den Rat des Anwalts angesprochen, reagiert sie trotzig: "Ich werde meine Gemeinschaft nie im Stich lassen", doch gleichzeitig beginnt sie zu weinen. Zum ersten Mal in all den Jahren erscheint die unermüdliche Kämpferin verzweifelt. Ein Kind nimmt sie in den Arm, auch dessen Mutter. Die Solidarität unter den Frauen ist groß. Sie stammen alle aus dem armen Nordosten von Brasilien. Sie alle haben mal auf der Straße gelebt und es gemeinsam rausgeschafft. Sie sind alle Aktivistinnen geworden.
"Ich schlafe an wechselnden Orten", erzählt Dona Carmen. "Aber tagsüber bin ich hier. Das ist mein Baby."

Sozialhilfe von unten für unten
Sie blickt auf das, was sie schon geschaffen haben und was noch nicht zerstört wurde: Eine Großküche für die Armenspeisung. Einen Gemeinschaftsgarten, wo sie Kürbisse, Tomaten und Bohnen anbauen. Ein Ausbildungszentrum, für das sie Nähmaschinen und Kochherde angeschafft haben. Sie nennen es Sozialhilfe von unten für unten. Sie haben nie die Hilfe von wohlmeinenden weißen Feministinnen gebraucht. Und keine Organisationen, die für viel Geld Entwicklungshelfer einfliegen.
Dona Carmen führt durch den Gemeinschaftsgarten an die Autobahn. Sie haben alles wieder angebaut seit dem ersten Brandanschlag – Melonen, Mais, Kräuter, ein Dutzend Mangobäume sollen dazukommen. Sie führt zu einem erweiterten Sportplatz für die Kinder und zurück zur Ruine und stapelt Backsteine aufeinander, als wollte sie sofort mit dem Neuaufbau beginnen. 120 Kinder sollen hier betreut werden, wenn deren Mütter bei der Arbeit sind, als Verkäuferinnen, Putzfrauen, Hausangestellte – als Rückgrat der Gesellschaft.
"Hier stecken Jahre des Kampfes drin. Ich bleibe, auch wenn ich sterben muss", sagt sie, nicht ohne Pathos. "Dann sterbe ich im Bewusstsein, für das Gerechte gekämpft zu haben."
Mit 30 Bewohnerinnen zum Mafiaboss
Von der Sandstraße nähern sich jugendliche Mitglieder der Drogengang. Sie bemerken den Journalisten, den sie Gringo schimpfen. Sie führen den Finger an die Schläfe, ein Hinweis, wer hier die Macht hat.
Das ist die Konstellation: Frauenpower versus organisierte Kriminalität und Staat.
Anfang April ein letzter Videoanruf: Dona Carmen ist am Leben. Sie hat den Polizeichef zu einem Treffen herausgefordert. Sie hat 30 Bewohnerinnen zum Mafiaboss geschickt.
"Sie glauben doch nicht, dass ich in die Knie gehe", sagt sie und lacht ihr breites, zahnloses Lachen.