Da war dieser eine Arzt, der in dem ganzen Wahnsinn das Fähnchen noch hochhielt. Ein Arzt im Kongo, diesem von Kriegen und Hunger gebeutelten Land, der vergewaltigte und misshandelte Frauen nicht nur medizinisch versorgte, sondern ihnen eine Ausbildung vermittelte, eine Perspektive und ein kleines bisschen Hoffnung. Nicola Grewe sah in sein Gesicht, las über seine Arbeit. Was für eine Kraft, was für ein Mut, dachte sie, ein Mensch gegen das totale Chaos, einer, der weiß, dass um ihn herum der Wahnsinn trotzdem weitergeht, die Not, die Gewalt, egal, was er tut, egal, wie viel er gibt. Und der einfach weitermacht.
"Ich weiß nicht, ob ich das könnte", sagt die studierte Betriebswirtin aus Berlin, 51 Jahre alt, Mutter, Personalreferentin beim Rundfunk. Und dann verbessert sie sich: "Doch, ich weiß: Ich könnte das nicht."
Aber etwas könnte sie ja tun.

Mit Ihrer Spende unterstützen wir ausgewählte Hilfsorganisationen.
Stiftung stern,
IBAN: DE90 2007 0000 0469 9500 01
BIC: DEUTDEHHXXX
www.stiftungstern.de
Afrika also, Kongo. Wie kommt eine Personalreferentin aus Berlin dazu, für ein Projekt im Kongo ihr Herz zu öffnen? Wie kommt eine 80-jährige Feinkosthändlerin dazu, für junge Frauen in Ruanda zu geben? Wie kommen überhaupt Leute dazu, für einen entlegenen Winkel dieser Erde oder ein Projekt gleich um die Ecke auf einen Restaurantbesuch zu verzichten oder auf einmal Schwimmen im Monat, oder auch nur auf einen höheren Kontostand bei ihrer Bank? Tun sie das, weil sie über die Not lesen? Weil sie wissen, dass anderswo Menschen leiden, hungern, Hilfe brauchen? Das sind ja wahrlich keine News, das steht auch nicht nur im stern, das liest und hört man überall, jeden Tag.

Viele haben ja Gründe, nicht zu helfen, sich nicht zu engagieren, kein Geld zu spenden, persönliche Gründe, politische Gründe. Dass es nicht viel ändert zum Beispiel, dass sie selbst zu wenig haben oder bekommen, dass es Leute abhängig macht, dass unfaire Systeme stabilisiert werden. Aber wer hilft, hat auch Gründe. Persönliche Gründe, politische Gründe.
Was also sind das für Leute, die für die Projekte der Stiftung stern mal hundert Euro spenden und mal tausend, manchmal sogar mehr, und manchmal fünf Euro, jeden einzelnen Monat, die sie sich vom Mund absparen, weil sie selbst nicht viel haben? Und warum geben sie gerade jetzt, in diesem schwierigen Jahr, das eines der spendenstärksten ist, die die Stiftung stern jemals hatte. Wo man annehmen könnte, die meisten Leute denken jetzt erst einmal an sich selbst. Aber nein, die Leute denken offenbar sehr viel an andere, gerade jetzt.
Auf der Suche nach unseren Spendern haben wir vor dem Lockdown eine Reise durch Deutschland gemacht, teils analog, teils digital, eine Live-Schalte in die Küchen und Wohnzimmer von Menschen, die helfen wollen und es dann auch machen. Die Fragen haben und manchmal Zweifel, ob es gut ist, ob es genug ist, ob es was bewirkt und ob es das Richtige ist. Und die es trotzdem tun.
Linus Rauer, 66, pensionierter Werklehrer, lebt in Ringsheim, 30 Kilometer nördlich von Freiburg, an einer Straße, die viele benutzen, die in einem nahe gelegenen Freizeitpark Karussell fahren wollen oder Achterbahn. Er spendet für das Sunshine-Kinderprojekt in Indien, für einen Ort, an dem obdachlose oder sehr arme Kinder nicht nur Essen erhalten, sondern auch Schulbildung. Ein Projekt, initiiert von einem indischen Ehepaar, das eines Tages ein Zweijähriges an einer Hauptstraße um Essen betteln sah und einfach nicht mehr wegsehen konnte. Rauer las darüber im stern, und er konnte auch nicht wegsehen. Wegen der Armut, wegen der Eigeninitiative und wohl auch, weil Kinder und Bildung und Eigeninitiative die Themen seines Lebens sind. Und er dachte über seine Straße nach.

Er hat ja schon immer gespendet. Er will da kein großes Ding draus machen, und deswegen sollen wir eigentlich nicht darüber schreiben, aber so viel kann man sagen: Er gibt Geld ab, seit er selbst welches verdient, und das ist schon sehr lange der Fall.
Drechseln für Kinder in Delhi
Sein zweites Lebensthema ist das Werken. Und deshalb fing Linus Rauer an, Drechselarbeiten, Christbaumschmuck, Kerzenständer, auf einem Tisch vor dem Haus an seiner Straße zu präsentieren und eine Kasse danebenzustellen. Wer mag, kann anhalten und ein Stück erwerben, Geld in die kleine Kasse werfen, der Erlös geht an das Sunshine-Projekt in Delhi.
Dauerte nicht lange, da stellte sein Nachbar Laubsägearbeiten dazu. Dauerte nicht lange, da fing die Frau vom Nachbarn an, Adventskränze zu binden. Dauerte nicht lange, da brachte die Nachbarin ein paar Straßen weiter aus dem Dorf Marmelade. Jeden Morgen tragen sie nun ihr Tischchen raus, an die Straße, die durch ihr Dorf führt, jeden Abend tragen sie das Tischchen wieder rein, alles eingenommene Geld geht an die Kinder im 6182 Kilometer entfernten Delhi. Zurzeit hat Linus Rauer echt Stress, jeden Tag gehen allein zwischen fünf und zehn gedrechselte Tannenbäume weg.
Könnte man sagen: Das ändert doch nichts. Könnte man naiv finden oder irgendwie klein. Könnte man aber auch groß finden und der Meinung sein, Nachbarn wie in Ringsheim, 30 Kilometer nördlich von Freiburg, kann es gar nicht genug geben.
Erinn Carstens-Doll aus München hat im Sommer ihr erstes Kind bekommen, ein kleines Mädchen. Sie weiß noch, wie sie, zu Besuch bei den Schwiegereltern, ihr Baby auf dem Arm hatte, sauber und satt, es trug einen weißen Strampler, und wahrscheinlich schlief es, genau weiß sie das nicht mehr, ein friedlicher Moment jedenfalls, und es gibt ja wenig Friedlicheres als ein schlafendes Kind.

Dann sah sie die Bilder aus Moria. Sah verkohlte Überreste des Lagers, sah zerrissene Planen, sah eine Mutter, die mitten im Dreck versuchte, ihr Baby in einer alten Wanne zu waschen.
Sie dachte: Das ist einfach unfair. Sie dachte: Ich möchte jetzt, in diesem Moment, sofort etwas tun. Ganz kurz dachte sie: Ist es wirklich okay, da jetzt einfach Geld rüberzuwerfen? Müsste man nicht viel mehr machen? Dann dachte sie nur noch: Okay, wie viel? Zehn Euro, hundert? Und sie beschloss: Ich will es auch merken. Sie gab 1000 Euro.
Ursula und Helmut Richter sind beide 80 Jahre alt. Sie leben in Getmold, was ungefähr so klein ist, wie es sich anhört, 800 Einwohner, und ein Teil von Preußisch-Oldendorf, Westfalen. Helmut Richter ist gelernter Gärtner, hat aber viele Jahre als Fernfahrer gearbeitet. Als Rückladung nahm er oft Lebensmittel für die in Deutschland lebenden Gastarbeiter mit, bis er irgendwann fand: Das kann man doch professionell aufziehen. Das ist doch eine gute Geschäftsidee! Er kündigte, und mit seiner Frau, einer gelernten Verwaltungsangestellten, gründete er eine Feinkost-Importfirma. Trotz dreier kleiner Kinder, trotz eines Startkapitals von nur 1000 Mark. Die hatten Eier, würde man heutzutage sagen.
Die Kinder sind inzwischen erwachsen, und die Firma ist inzwischen ein Unternehmen mit Filialen in Chile und Griechenland, und die Richters sind, das kann man nicht anders sagen, vergnügte Leute. Sie haben immer noch andauernd jede Menge Ideen, die sie auch umsetzen, Helmut Richter ist zu seiner Leidenschaft, den Gärten, zurückgekehrt, legt Themengärten an und kombiniert Gärten und Feinkost. Ein Sohn leitet den Unternehmensteil in Chile, ein anderer Sohn wohnt um die Ecke und führt die Firma in Deutschland, die beiden reisen viel, nehmen sich aber auch Zeit für ihre vielen Interessen. Es gibt also auf den ersten Blick wenig Grund für die Richters, sich in die traurigen Seiten des Lebens zu vertiefen.

Aber sie tun es. Sie spenden für vergewaltigte Frauen in Ruanda, weit weg. Für Flüchtlingskinder in Griechenland, nicht so weit weg. Und sie sammeln Spenden. Als sie kürzlich 50 Jahre Selbstständigkeit feierten, baten sie um Spenden statt irgendwelcher Geschenke. 12.000 Euro kamen zusammen. Warum machen die das?
Natürlich, Helmut Richter hat die Welt bereist, erst als Fernfahrer, dann als Unternehmer, und er hat Elend gesehen unterwegs. Sie lesen Zeitung, sie hören Nachrichten, sie sind auf dem Laufenden, und sie haben einfach Mitgefühl. Aber man muss noch ein paarmal nachfragen, erst dann erzählt Helmut Richter einem von dem Moment in seinem Leben, der ihn für immer geprägt hat.
"Ich bin in Oberschönau geboren, in Thüringen", sagt Richter, "da geht eine Straße durch das Tal, und da rückten Soldaten an." Der Großvater hatte die Familie in den Keller geschickt. Helmut war fünf Jahre alt und kletterte auf die Kartoffelkiste, um zu sehen, was draußen passierte. "Ich habe Männer in schwarzen Uniformen gesehen, die mit Gewehren zerlumpte Gefangene vor sich hertrieben. Und genau vor meinen Augen, das muss so fünf, sechs Meter gewesen sein, stürzte einer dieser Gefangenen zu Boden, weil er schwach war und mit einem Gewehrkolben gestoßen wurde. Rührte sich nicht. Und dann kamen die anderen zurück, hoben ihn auf und trugen ihn davon. Dieses Bild, das habe ich nie vergessen."
Daniel Catalano hat schon früh entschieden, sich in seinem Leben den glücklichen Dingen zuzuwenden. Er arbeitet als Coach und Trauredner, er spricht auf Hochzeiten, die nicht in der Kirche stattfinden. "Ich begleite Leute ins Glück", sagt er.

Catalano nennt sich Italo-Schwabe, ist als Gastarbeiterkind in Deutschland aufgewachsen, aber fest verankert in der italienischen Community. Und bei seinen Eltern und den Erwachsenen, die er kannte, gehörte der ehrenamtliche Einsatz für andere zum Leben wie das morgendliche Zähneputzen. "Da denkt man gar nicht drüber nach", sagt Catalano, "das ist einfach so." Er hat in Amerika studiert, wo Wohltätigkeit noch eine andere Rolle spielt, weil der Staat vieles nicht leistet, aber auch in Deutschland, findet er, kann man sich darüber auseinandersetzen, für wen man spendet und ob eine Spende ankommt und was sie bewirkt. "Aber dass Spenden Sinn macht und sehr viel Kraft hat und auch sehr viel Verbindung schafft, steht für mich außer Frage."
Elke Quabeck renoviert gerade ihr Haus an der Ostsee, in das sie frisch eingezogen sind, man kann sie erst nach 16 Uhr sprechen, weil es dann dunkel ist und sie eh aufhören muss, ihre Wände zu pinseln. Sie ist Industriekauffrau, kommt aus kleinen Verhältnissen, heute ist sie selbstständig und vertreibt Sitzmöbel. "Dank Abitur, Studium und Ausbildung, was in den 70er Jahren auch für Kinder aus weniger begüterten Familien erreichbar war, lebe ich jetzt ohne finanzielle Sorgen."

Bis zu einem Bericht über das Kinderhilfsprojekt "Arche" vor etlichen Jahren war ihr nicht bewusst, dass es in Deutschland Kinderarmut gibt, geschweige denn, dass es Kinder in Deutschland gibt, die morgens ohne Essen im Bauch in die Schule gehen – sie ist dann Spenderin geworden. "Manche sagen, wenn ein Promi Geld spendet, ja der, der kann das ja. Bin ich anderer Meinung", sagt sie trocken. "Jeder kann das. Muss ja nicht ’ne Million sein. Muss überhaupt auch kein Geld sein. Jeder kann irgendetwas beitragen."
Arme reiche Leute
Irmtraud Stenzel ist 68 Jahre alt und hat viele Jahre in Berlin als Vorklassen-Lehrerin gearbeitet. Vor einigen Jahren ist sie in ihre süddeutsche Heimat zurückgekehrt. Sie musste früh für ihre Geschwister sorgen, so etwas prägt wahrscheinlich. Sie spendet für Flüchtlingskinder und für ein Projekt von Frauen in Brasilien, die in einem Elendsviertel ein Frauenhaus betreiben, das vor Gewalt schützt und Begegnungen ermöglicht. Zu Hause betreut und unterstützt sie seit vielen Jahren Flüchtlingsfamilien, vor allem Roma, teils auch Jahre nach ihrer Abschiebung noch. Und dafür sammelt sie selbst Spenden. Warum also, fragen wir Frau Stenzel, gibt es Leute, die sagen: Ich fühl mich angesprochen, und an anderen geht so ein Aufruf komplett vorbei?

"Ich will Ihnen dazu eine Geschichte erzählen", sagt Irmtraud Stenzel. "Ich war eingeladen bei einer reichen alten Dame, die in einer Villa lebt, die vier Küchen hat, vier Terrassen und vier Abstellkammern. Und aus diesen Abstellkammern gab sie mir dann Sachen für meine Sammlung, für den Kleiderladen, sehr edle Kleidung von Dior und so, aber 30 Jahre alt, total altmodisch. Ich musste, bevor ich die Sachen mitnahm, mit ihr zusammen die Etiketten raustrennen, damit die Flüchtlinge nicht mit Dior-Klamotten herumlaufen wie sie selbst. Und da hab ich gedacht: Diese Frau, die hat einfach nichts übrig für andere. Die hat selbst nicht genug, die ist eigentlich arm. Geben kann nur, wer etwas übrig hat, und das bezieht sich nicht unbedingt aufs Geld."
Rolf Murschall hat immer etwas übrig. Er hat sich als Betriebsrat engagiert, er kämpft für den Umweltschutz, spendet für Bootsflüchtlinge. Dabei hat er selbst nicht viel. Er lebt in einer umgebauten Scheune von Erwerbsunfähigkeitsrente. Der ehemalige Starkstromelektriker hatte zwei schwere Unfälle, er lag drei Monate mit Schädel-Hirn-Trauma im Koma. Manch einer würde in so einer Situation sagen: Ich habe viel Pech gehabt. Aber Murschall findet: Er hat viel Glück gehabt. Er trainierte sich mit eisernem Willen zurück ins Leben. "Ich habe mich aus jeder Misere, in die ich mich reingeritten habe, auch wieder rausgekämpft", sagt Murschall, und es klingt, als seien es einige gewesen. Zehn Prozent seines kleinen Einkommens gibt er für soziale Zwecke, fünf Euro im Monat gehen an die Stiftung stern für ein Kinderprojekt in Brasilien. "Fünf Euro für einen Monat Schule, ich bitte Sie", sagt Murschall. "Das sind für mich zwei Kaffee im Monat." Hilfe zur Selbsthilfe, so etwas fasziniert ihn, und man ahnt, warum.
Also: Was sind das für Leute? Sie sind jung, sie sind alt, aus dem Osten, dem Norden, dem Westen und dem Süden. Es sind: dankbare Leute. Sie haben oft selbst erfahren, dass man sich Glück nicht erarbeiten kann und dass Lebenschancen auch von Zufällen bestimmt werden. Sie denken, dass nicht jeder bekommt, was er verdient, nicht im Guten, nicht im Schlechten. Die einen spenden, weil es ihnen gut geht, weil sie etwas erreicht haben, weil sie Glück hatten. Andere spenden, weil einiges schiefgegangen ist in ihrem Leben. Sie spenden, obwohl sie Pech hatten oder vielleicht: weil sie Pech hatten und einfach wissen, wie das so ist. Und wie gut eine kleine Unterstützung tut, materiell, aber auch die pure Geste.
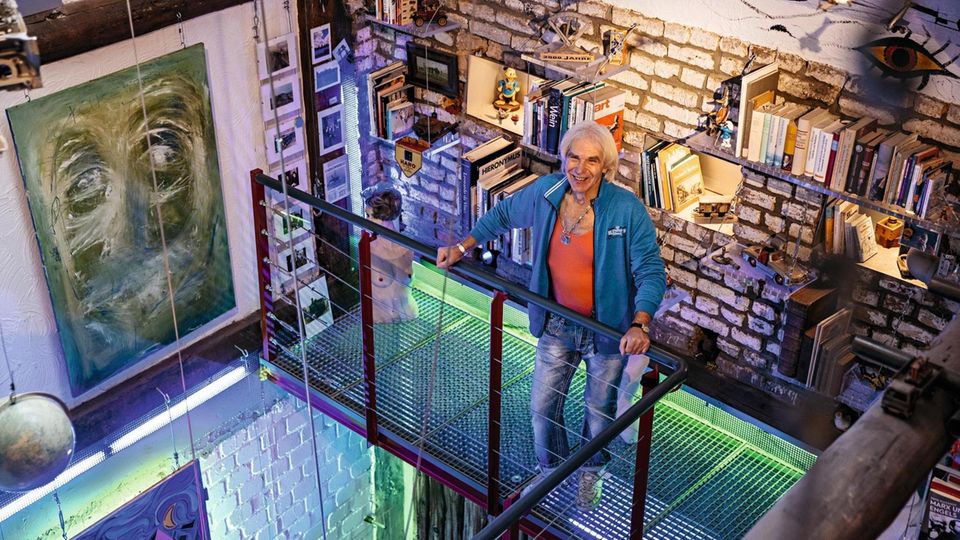
Was fragt man noch, wenn eine 82-Jährige einem erklärt, dass sie für Frauenhäuser in Ruanda spendet, weil ihr Mann sie misshandelt hat? Wenn eine junge Frau erklärt, sie sei schwer krank und deshalb helfe sie, denn sie wisse nun mal, wie kostbar und unwiederbringlich das Leben ist?
Es sind Leute, die mit 16 schon einen Erste-Hilfe-Schein gemacht haben und den auch immer wieder auffrischen. Und die, logisch, auch immer wieder auf Leute stoßen, die Hilfe brauchen. Fragen ihre Freunde sie: Warum passiert das immer dir, dann wissen sie keine Antwort, außer: Man muss den Hilfsbedarf auch sehen wollen. Es sind Leute, die immer Kleingeld in der Tasche haben, und zwar nicht nur für den Busfahrschein. Sie sind Abgeber, nicht Angeber, sie haben oft noch andere Projekte, die sie unterstützen, mit Geld, mit Zeit, mit Engagement. Sie haben mehr Fragen als Antworten, auch Fragen an sich selbst. Die schieben nicht einfach nur Geld rüber. Die machen sich Gedanken. Die wissen, dass nicht immer alles klappt. Spenden, sagt einer, ist Mitgefühl zum Anfassen.






