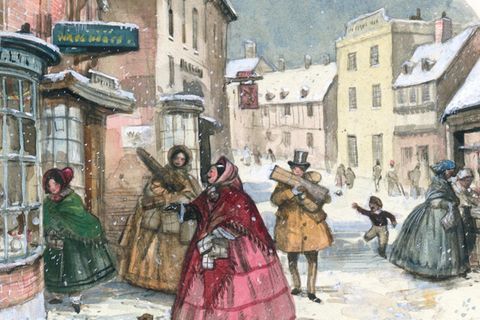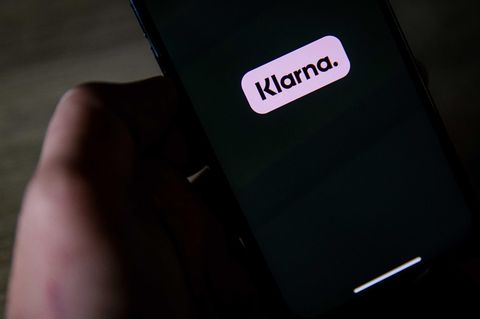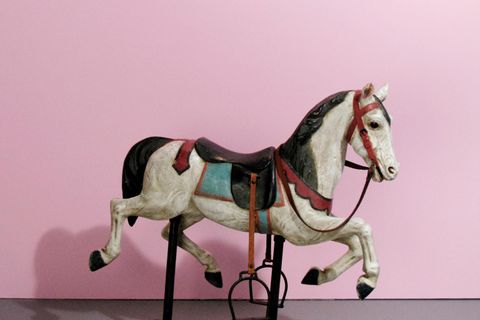Haben, haben, haben, dachte Katrin Becht, als sie ihn das erste Mal sah – den goldenen Ring mit weißer Perle. Spontan fasste sie einen Entschluss: Ein ganzes Jahr lang wollte sie keine Kleider kaufen, um sich am Ende etwas Besonderes leisten zu können. Am Anfang ging es Katrin Becht nur um den Ring.
Ab sofort galt: kein schneller Klick mehr auf eine Bluse, wenn sie Stress hatte. Keine neuen Turnschuhe mehr im Onlinewarenkorb, wenn sie sich belohnen wollte. Kein Zurückschicken all der Pakete mit Sachen, die dann doch nicht passten. Es wurde Sommer, es kam ein neuer Trend, Blümchen-Schlabberhosen – aber diesmal ohne sie!
Katrin Becht hatte plötzlich nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Zeit. Sie begann, sich darüber zu informieren, wie ihre Kleidung eigentlich hergestellt wurde und wie hoch der Tageslohn einer Näherin in Bangladesch ist. Die 38-jährige PR-Referentin fragte sich: Seit wann war Shoppen für sie ein Hobby, warum kaufte sie Dinge, die sie gar nicht brauchte? Gab es nichts Wichtigeres?
Sein statt Haben
Bis vor einigen Jahren galt noch: Ein gutes Gewissen kann man kaufen. Das Idealbild war der "kritische Konsument", der nicht zum nächstbesten Schnäppchen greift, sondern wissen will, wo sein Essen und seine T-Shirts herkommen.
Jetzt ist es wichtig, was man nicht kauft. Denn auch bei der Herstellung eines T-Shirts aus Biobaumwolle werden Unmengen Wasser verbraucht, das Shirt wird oft um den halben Globus transportiert. Nachhaltiger als ein nachhaltiges T-Shirt ist: gar kein T-Shirt. Umweltfreundlicher als ein sparsames Auto ist: gar kein Auto.
Es gibt jetzt ein neues Idealbild, das des einfachen Lebens. Die doppelte Verheißung: Man rettet – vielleicht – die Erde und – ganz bestimmt – sich selbst. Wer sich bescheidet, so das Versprechen, muss nicht mehr jedem Trend nachjagen. Er kann mit Gütern haushalten – und Gefühle verschwenden. Er wohnt vielleicht auf weniger Quadratmetern mit weniger Dingen. Doch er befreit sich aus den Zwängen von Schuften und Shoppen, Besitzen und Entrümpeln und kann sich so aufs Wesentliche konzentrieren – Beziehungen, Erlebnisse, Arbeit, die Freude macht. Er fastet nicht nur zwischen Aschermittwoch und Ostern – er verzichtet länger, umfassender, für ein besseres Leben.
Allerdings möchten die meisten dabei nicht von Verzicht sprechen – lieber von "Zeitgewinn", "neuer Einfachheit" oder dem "Prinzip Verantwortung". Verzicht – das klingt harsch, aufgesetzt, unfreiwillig. Über Jahrtausende war der Mensch damit beschäftigt, gegen den Mangel zu kämpfen. Die Großeltern mussten bescheiden leben – ihre Enkel möchten es. In Budapest forderten im September internationale Forscher bei einer "Degrowth"-Konferenz die Abkehr von Leistungsdenken und Wachstumswahn. "Relax statt Rolex!", postuliert das Zeitgeist-Magazin "Transform".
"Free your Stuff"
In unzähligen Blogs und Foren berichten Menschen, wie sie ihren Besitz auf 100 Dinge geschrumpft haben. Sie nennen sich Minimalisten oder Postmaterialisten, Freeganer oder Neo-Malthusianer. Für den neuen Lebensstil gibt es mehr Titel, als manche seiner Anhänger Dinge haben. "Wer teilt, hat mehr", skandieren sie und leihen sich kostenlos Schneeschuhe und Bohrmaschinen. Einige zeigen, wie man ein "Tiny House" errichtet, ein winziges Holzhaus, das man per Anhänger transportieren kann. Andere leben leidenschaftlich "ohne": ohne Plastik, ohne Fleisch, ohne Müll. Europaweit haben sich "Verschenk-Gruppen" organisiert, ihr Motto: "Free your stuff" – befrei dein Zeugs.
Wohlstandskinder befreien sich von ihrem Wohlstandsplunder. Man könnte ihre Sehnsucht nach Einfachheit als fortschrittsfeindlich bezeichnen. Oder auch als naiv. Was bringt es, wenn sie Fahrrad fahren – aber der Nachbar weiter in den Geländewagen steigt? Was richten sie mit ihrem bisschen Weniger aus in einer Zeit, in der in den mächtigen USA "Nach mir die Sintflut"-Egomanen regieren? Und hat nicht erst der Konsum sie so satt gemacht? Ist Kauflust nicht der Kraftstoff, der die Wirtschaft antreibt, Wachstum beschert und damit Jobs?
Es ist leicht, sich über die neue Bewegung lustig zu machen. Die Versuchung liegt so nahe, weil ihre Anhänger das Lebenskonzept der meisten Deutschen radikal infrage stellen. Aber ihre Fragen sind ernst: Wofür arbeiten wir? Was ist uns wichtig? Was macht ein gutes Leben aus?
Noch besitzt der Durchschnittsdeutsche etwa 10.000 Dinge. Doch fast jeder Dritte kann sich vorstellen, Eigentum abzuschaffen und Sharing-Angebote zu nutzen, etwa beim Auto oder bei Haushaltsgegenständen. 40 Prozent der Deutschen glauben, es täte ihnen gut, auf Karriere und Konsum zu verzichten.
Der stern hat Menschen besucht, die weniger wollen. Manche verbieten sich den Klamottenkauf – wie Katrin Becht. Andere setzen auf Selbstversorgung oder versuchen, ganz ohne Geld zu leben. Fast alle sind Überzeugungstäter. Ihr Ziel ist dasselbe, doch sie gehen dabei unterschiedliche Wege.
Zwei Berater teilen sich einen Job
Christoph Karsten und Nicolas Woldmann wollten einen Job, der sie ernährt, aber nicht auffrisst. Eine 20-Stunden-Woche für jeden müsste reichen, fanden sie. Also beschlossen die beiden Unternehmensberater, sich eine volle Stelle zu teilen. Gemeinsam verfassten sie eine Bewerbung und schickten sie der Osnabrücker Unternehmensberatung CMX. Der Chef Claudio Felten fand die Idee interessant. Die Vorteile aus seiner Sicht: "Für ein Gehalt bekommen wir zwei Menschen, die mehrere Sprachen sprechen. Wenn der eine müde ist, ist der andere wach." Felten glaubt ohnehin, dass selbst in einer konservativen Branche wie der Unternehmensberatung die "Zeit der 60-, 80-Stunden-Wochen vorbei ist".
Gefunden haben sich Nicolas Woldmann, 44, und Christoph Karsten, 49, über die Agentur Tandemploy, gegründet von zwei Berliner Personalberaterinnen. Über einen Algorithmus ähnlich der Online-Partnervermittlung finden sich hier Paare für den Job. Ein Drittel der Interessenten sind Männer.
Für große Urlaubsreisen reicht das halbe Gehalt bei Karsten und Woldmann nun kaum mehr. Karsten war im Sommer mit dem VW-Bus in Österreich, "das reicht völlig" . Und eben habe er eine "alte, aber geile" orangefarbene Hose wiederentdeckt, da brauche er erst mal nichts Neues zu kaufen.
Die meisten wirtschaftswissenschaftlichen Theorien beruhen bis heute auf dem Idealtyp des "Homo oeconomicus": ein Gierschlund, getrieben vom Wunsch, immer mehr anzuhäufen. Was aber passiert, wenn sich der Mensch gar nicht nach Waren und Besitz verzehrt? Wenn er etwas anderes braucht zu seinem Glück?
Eine folgenschwere Reise
Genau das hat Raphael Fellmer erlebt. Er hat fünf Jahre lang gar nichts gekauft. Er war im "Geldstreik", so nennt er es.
Alles begann mit einer Reise: Raphael Fellmer studierte Europäische Wirtschaft, als Freunde ihn zu ihrer Hochzeit nach Mexiko einluden. Er fasste einen Plan: Warum nicht nach Mexiko per Schiff und Anhalter, ohne Geld? Mit seinen zwei besten Freunden schlug er sich über Marokko und die Kapverden durch bis nach Südamerika. Einheimische gaben ihnen zu essen und ein Nachtlager. Raphael Fellmer sah, wie Regenwald gerodet wurde und Pestizide auf Äckern versprüht wurden, um Soja für die Rinder Europas anzubauen. Er sah Müllhalden voller Plastiktüten und sprach mit Arbeitern, die ohne Schutzmasken in beißendem Dampf Jeans bleichten. Nach elf Monaten kam er in Mexiko an – leider sechs Monate zu spät, die Freunde hatten längst ohne ihn geheiratet.
Nach dieser Reise kehrte Raphael Fellmer nicht mehr zurück in sein altes Leben. Er ackerte hart dafür, kein Geld mehr zu brauchen. Kein Konsument mehr zu sein. Mit seiner spanischen Frau Nieves und der kleinen Tochter Alma ernährte er sich von dem, was die Wohlstandsgesellschaft nicht mehr will. Sie holten Reste von Supermärkten, bekamen Kleider und Möbel geschenkt und reparierten sie. Wohnen konnten sie bei Freunden.
Manche warfen ihnen vor, sie seien Schmarotzer. Was wäre, wenn alle so lebten? "Wir nehmen nur, was andere übrig lassen", entgegneten sie.

Millionen Dinge landen in der Tonne
Konsumieren, das kommt vom lateinischen "consumere" , verzehren, aufbrauchen. Doch die Deutschen verbrauchen nicht mehr, was sie kaufen. Und sie pflegen nicht, was sie besitzen. Laut einer Greenpeace-Umfrage waren die meisten der 18- bis 29-jährigen Deutschen noch nie beim Schuster. Als Wissenschaftler die ausrangierten Handys von 4000 Hamburgern untersuchten, stellten sie fest, dass nur etwa ein Drittel kaputt war – die meisten Geräte funktionierten einwandfrei. Viele Produkte sind so konstruiert, dass sie nur eine gewisse Zeit halten. Bei anderen kann man keine Ersatzteile austauschen. Jedes Jahr landen in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen Elektroschrott und 400.000 Tonnen Schuhe und Kleider im Müll. Auch ein Drittel der Lebensmittel endet in der Tonne.
Zusammen mit Gleichgesinnten gründete Raphael Fellmer die Organisation Foodsharing. Mittlerweile sammeln über 25.000 Freiwillige Reste bei Supermärkten, Restaurants und Privatpersonen ein, essen sie selbst oder legen sie in die "Fairteiler", Kühlschränke an öffentlichen Orten, aus denen sich jeder etwas nehmen kann. Als nächsten Schritt will Fellmer mit einem neuen Startup überschüssige Lebensmittel direkt bei Landwirten und Großhändlern abholen, sie rasch an Interessenten ausliefern lassen – und sich dann auch ein Gehalt auszahlen.
Raphael Fellmer ist jetzt wieder ein Mann mit Geld. Die Freunde, die ihn und seine Frau mit inzwischen zwei kleinen Kindern aufgenommen hatten, zogen um, und Fellmers fanden keine neue kostenlose Bleibe. "Kinder brauchen einen festen Ort, ich kann mit ihnen nicht ständig umherziehen" , sagt Raphael Fellmer. Jetzt leben sie zum ersten Mal allein in einer Mietwohnung, Fellmer nimmt neuerdings Geld für seine Vorträge. Er hat jetzt auch ein Handy. Raphael Fellmer drückt das anders aus. Er sagt: "Ich habe den Luxus aufgegeben, ohne eigenes Handy zu leben." Beim Reisen bleibt er konsequent. Die Eltern seiner Frau Nieves sind Mallorquiner, und wenn Fellmer sie besuchen will, setzt er sich nicht in einen der vielen Ferienflieger, sondern verbringt anderthalb Tage im Zug und auf der Fähre.
Manche steckt seine Form von politischer Korrektheit an, andere reagieren genervt. Ist ein solches Leben nicht freudlos? Fast schon fanatisch? Fellmer hofft, dass mehr Menschen sich ändern, "aber verordnen kann man das nicht, nur vorleben. Mit erhobenem Zeigefinger erreicht man die Leute nicht."
Soll man Flughäfen und Autobahnen schließen?
Der Wirtschaftswissenschaftler Niko Paech ist da anderer Ansicht. Er hat selbst kein Auto, kein Handy und keinen Fernseher und wirft den Deutschen vor, ein "ökologisches Doppelleben" zu führen: "Es bringt nichts, im Biosupermarkt einzukaufen und dann in den SUV zu steigen." Früher glaubte Paech, man müsse "die Menschen behutsam und Schritt für Schritt" an ein ökologisches Leben heranführen, inzwischen ist er davon überzeugt, "dass wir jetzt unser Leben radikal ändern müssen". An einem bescheideneren Lebensstil führe kein Weg vorbei. Paech verweist auf den sogenannten Rebound-Effekt: Wenn etwa Autos sparsamer werden, aber auch größer, schwerer und leistungsstärker, bleibt der Nutzen für die Umwelt gering. Viele 20-Jährige hätten heute schon mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen als sein Großvater im Laufe seines ganzen Lebens. Paech fordert eine "Rückkehr zur Sesshaftigkeit" . Er will möglichst viele Flughäfen und Autobahnen schließen. Mit seinen unbequemen Thesen ist der Forscher, der zu internationalen Konferenzen nicht anreist, wenn er dafür fliegen muss, zum Star einer wachstumskritischen Bewegung in Europa geworden.
Schon vor mehr als 40 Jahren, 1972, als der Club of Rome die Studie "Die Grenzen des Wachstums" veröffentlichte, stellte sich eine zentrale Frage: Muss der Einzelne seinen Lebensstandard herunterschrauben, oder – für die Menschheit viel angenehmer – wird technischer Fortschritt die Erde retten?
Ein Report des UN-Umweltprogramms UNEP beschrieb im vergangenen Jahr, wie sich der Rohstoffverbrauch zwischen 1970 und 2010 mehr als verdreifacht hat, wie Vorräte an Öl, Kohle, Metallen, Seltenen Erden und Sand ausgebeutet werden. Jeden Tag sterben mehrere Arten aus und werden Zehntausende Hektar Wald abgeholzt.
China zwingt seine Bürger zum Umweltschutz
Lassen sich Wachstum und Umwelt versöhnen? Ralf Fücks, Grünen-Politiker und Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, setzt auf eine "grüne industrielle Revolution", auf "erneuerbare Energien, Flugzeuge, die mit Algenkraftstoff fliegen, und eine abfallfreie Kreislaufwirtschaft". Mit Verzicht oder gar einer "Erziehungsdiktatur" sei die Welt nicht zu retten, so Fücks. "Milliarden Menschen machen sich auf in ein besseres Leben. Sie kaufen ihr erstes Auto, wollen reisen und die Welt entdecken." Davon könne man sie kaum abbringen, schon gar nicht mit einem "Ökototalitarismus" nach chinesischem Vorbild. Auf den letzten europäischen Nachhaltigkeitskongressen war in der Tat immer wieder von Chinas rigiden Umweltauflagen die Rede. So wurden etwa in Regionen mit Millionen Einwohnern zügig Zweitaktmotoren durch Elektroantriebe ersetzt. Chinas Führung zwingt die Bürger zum Umweltschutz, nachdem sie jahrelang auf zügelloses Wachstum setzte und die Proteste von Umweltaktivisten unterdrückte.
Die meisten Forscher glauben, dass die Wahrheit in der Mitte liegt – zwischen Ralf Fücks' grenzenlosem Technikoptimismus und Niko Paechs asketischem Lebensstil. Alle sind sich einig, dass es ohne Auflagen und Anreize aus der Politik nicht geht, etwa für sauberere und kleinere Autos, nachhaltigere Landwirtschaft oder teureres Flugbenzin. Was würde passieren, wenn in den westlichen Wohlstandsgesellschaften immer mehr Menschen so bescheiden lebten wie Raphael Fellmer oder auf Shopping-Diät gingen wie Katrin Becht?
Bruttosozialglück statt BIP
Am 2. November haben fünf Experten, die sogenannten Wirtschaftsweisen, in Berlin ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2017 abgegeben. Das Ritual ist jedes Jahr das gleiche. Die Berater der Bundesregierung stützen sich dabei im Wesentlichen auf eine Zahl: das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, der Wert der in Deutschland produzierten Waren und Dienstleistungen. Damit das BIP steigt, müssen die Menschen mehr kaufen. Sie kurbeln damit die Wirtschaft an. Ob es ihnen danach besser geht, wissen die Wirtschaftsweisen nicht. Das BIP sagt nichts darüber aus, ob die Waren umweltschonend produziert wurden oder wer vom Reichtum in einer Gesellschaft profitiert.
Wenn es nach dem BIP und den Wirtschaftsweisen geht, leben die Menschen in dieser Geschichte falsch. Sie bremsen das Wachstum. Forscher suchen deshalb schon lange nach einem neuen Indikator, der den Zustand der Gesellschaft treffend beschreibt. Einen, der etwas viel Wichtigeres misst: Fühlen die Menschen sich wohl? Brauchen sie all die Dinge? So etwas wie: das Bruttosozialglück.
Die Glücksforschung zeigt: Das "gute Leben" verlangt durchaus nach einem gewissen Wohlstand. Armut macht unglücklich. Bedeutsamer als der Kontostand ist das Gefühl, nicht abgehängt zu sein, sich ähnlich viel leisten zu können wie Freunde und Kollegen. Doch ab einem bestimmten Punkt steigert Besitz das Wohlbefinden nicht mehr. Obwohl sich der durchschnittliche Deutsche heute dreimal so viel leisten kann wie noch zu Beginn der 80er Jahre, ist die Lebenszufriedenheit nahezu unverändert geblieben.
Selbstversorgerin im Wendland
Andrea Funcke bringt sehr schlicht auf den Punkt, was für sie ein gutes Leben ausmacht: "Dass ich satt und zufrieden bin und weiß, warum ich etwas tue." Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Andrea Funcke lebt auf ihrem kleinen Hof im niedersächsischen Wendland weitgehend als Selbstversorgerin. Auf den Elbwiesen weiden ihre Schafe. Die 49-Jährige strickt Pullis und filzt Stoffe aus Schafwolle, macht Käse und Butter. Im Garten wächst Gemüse und auch die "Kräuterapotheke" . Im Winter wärmt, mehr schlecht als recht, ihre selbst konstruierte "Eselmistheizung".
Andrea Funcke gibt auch Selbstversorger-Kurse: Sie macht Heu und backt Brot mit Erwachsenen und Kindern aus dem Umland. Funcke sagt, es gebe vor allem Kindern Sicherheit, wenn sie merkten, dass sie alles, was sie zum Leben brauchen, selbst herstellen können. Mit den Kursen verdient sie sich etwas dazu, denn, so sagt sie, "reine Selbstversorgung funktioniert nicht in Deutschland". Sie braucht Geld für den Tierarzt, die Steuern, die Versicherungen. Sie sieht abgekämpft aus, trotz ihrer tiefen Bräune und rosigen Wangen. Ihre Rente wird winzig sein, aber mit Sorgen mag sie sich nicht aufhalten. Fast jeden Tag sehe sie einen Sonnenuntergang, "dafür fahren andere Leute in den Urlaub". "Ich bin reich", sagt Andrea Funcke.
Studien zeigen, dass Materialisten weniger glücklich sind als Menschen, denen teure Handys oder dicke Autos gleichgültig sind. Besonders materialistisch seien Jugendliche in der Pubertät, sagt Jens Förster, Psychologieprofessor an der Uni Bochum. "Wenn aber ältere Leute oder Sterbende auf ihr Leben zurückblicken, ist es ihnen egal, wie groß ihr Haus ist und wie viele Teile ihr Silberbesteck hat. Es zählen die Erlebnisse mit Menschen, die einem wichtig sind." Förster hat ein Buch über die "Psychologie von Konsum und Verzicht" geschrieben. Darin unterscheidet er zwischen "Haben- und Sein-Zielen": "Sein-Ziele" seien mühsamer zu erreichen, so Förster. "Ein guter Vater zu sein, näher bei Gott zu sein, mehr Geduld mit meiner demenzkranken Oma zu haben – das sind gewaltige Vorhaben, dabei werde ich immer wieder scheitern. Aber das Glücksgefühl, das sie vermitteln, ist ungleich größer als der kurze Kick beim Shoppen."
Katrin Becht, die Frau, die ein Jahr lang nicht mehr einkaufte, weil sie scharf war auf einen Ring, sagt, sie habe all die Dinge, die sie schon hatte, erst in diesen Monaten so richtig schätzen gelernt. Sie ist Vegetarierin geworden und hat sich einen neuen Job gesucht, den sie "sinnvoller" findet. Sie arbeitet jetzt nur noch für Hersteller fair gehandelter Produkte. Sie geht mit kritischem Blick durch den Supermarkt und schaut, wo Palmöl drin ist: "Für Palmöl-Plantagen wird den Orang-Utans ihre letzte Heimat genommen. Das unterstütze ich nicht mehr!" Kürzlich war sie bei Freunden eingeladen, von draußen hörte sie Rufe: "Tu das schnell weg, die Katrin kommt!" Sie lacht: "Wahrscheinlich hatten sie was mit Palmöl drin. Ich bin jetzt der Moralapostel!"
Zum Schluss war ihr Kleiderschrank zwar nicht leer, aber er quoll auch nicht mehr über. Sie hatte viel Geld gespart.
Und der Ring? Ach, der. Den hat sie am Ende gar nicht gekauft.