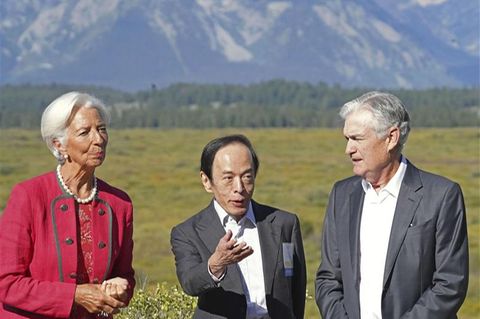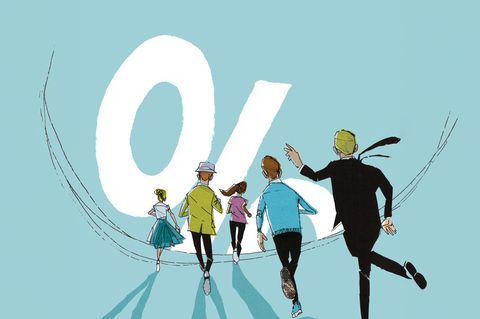Die Europäische Zentralbank (EZB) hat trotz heftigen politischen Gegenwinds ihre Ankündigung wahrgemacht und die Zinsen erstmals seit mehr als einem Jahr erhöht. EZB-Präsident Jean-Claude Trichet begründete die Anhebung von 4,0 auf 4,25 Prozent am Donnerstag in Frankfurt mit den gestiegenen Gefahren, dass der massive Teuerungsdruck zu einer Lohn-Preis-Spirale und einer Verselbständigung der Inflation führen könne. Ob die Notenbank im weiteren Jahresverlauf noch einmal an der Zinsschraube drehen will, wie am Finanzmarkt erwartet, ließ Trichet offen. "Wir haben keine Tendenz. Wir sind nie vorab festgelegt. Unsere Geldpolitik wird nach der heutigen Entscheidung dazu beitragen, mittelfristig Preisstabilität zu erreichen."
Die EZB nimmt mit dem Zinsbeschluss ihren vor mehr als einem Jahr wegen der Finanzkrise unterbrochenen Kampf gegen die Inflation wieder auf. Die Teuerungsrate in der Währungsunion war zuletzt wegen explodierender Energie- und Nahrungsmittelpreise auf den Rekordwert von vier Prozent gestiegen. "Die Inflation ist die Sorge Nummer eins der Bürger Europas. Sie können auf uns zählen. Wir werden tun, was nötig ist, um Preisstabilität zu gewährleisten", sagte Trichet.
Folgen für Verbraucher
Die Zinsanhebung der EZB wirkt sich für Verbraucher unterschiedlich aus. Während Kredite und Baudarlehen teurer werden, können sich Anleger über mehr Ertrag ihrer Sparkonten freuen. Die Banken reichen die höheren Zinssätze in der Regel aber nur teilweise und mit zeitlicher Verzögerung an die Kunden weiter.
Kredite
: Für Schulden müssen viele Verbraucher künftig höhere Zinsen zahlen. Die Banken und Sparkassen ziehen üblicherweise schnell nach und erhöhen die Sätze für Dispo-, Überziehungs- und Ratenkredite.
Sparguthaben
: Vielen Sparern und Anlegern bringt die Erhöhung Vorteile. Anders als früher geben die meisten Banken die steigenden Zinsen im Zuge der Finanzmarktkrise zügig an die Sparer weiter, weil sie auf ausreichend Liquidität angewiesen sind. Bei Tages- und Festgeld sowie bei Sparbriefen ist ein Zinsplus zu erwarten.
Baukredite
: Für Häuslebauer sind die langfristigen Zinsen am Kapitalmarkt entscheidend. Sie können, müssen aber nicht unbedingt mit dem Leitzins steigen. Immobilienkäufer, die einen Vertrag mit variabler Verzinsung abgeschlossen haben, müssen sich auf höhere Zinsen einstellen.
Bereits Anfang Juni hatte der Notenbankchef mit ungewöhnlich deutlichen Worten eine Zinsanhebung signalisiert. Die Notenbank ist besorgt über die hohe Inflation im Euro-Raum: Im Juni erreichte die jährliche Teuerungsrate infolge hoher Öl- und Nahrungsmittelpreise mit 4,0 Prozent den höchsten Stand seit Einführung des Euro am 1. Januar 1999. Das ist doppelt so hoch wie das Ziel von 2,0 Prozent, bei dem die EZB Preisstabilität definiert.
Höhere Zinsen helfen im Kampf gegen die Inflation, weil Kredite teurer werden. Kritiker warnen, steigende Zinsen könnten Hunderttausende Arbeitsplätze gefährden. Ungeachtet der Kritik setzt die EZB mit der Zinserhöhung ihren bisherigen Kurs fort: Wegen der Finanzmarktkrise hatte die Notenbank auf einen bereits für den vergangenen Sommer geplanten Zinsschritt nach oben verzichtet.
Gewerkschaften sehen Arbeitplätze gefährdet
Die Gewerkschaften sehen durch die Zinserhöhung massiv Arbeitsplätze gefährdet. "Die EZB schwächt dadurch die Konjunktur und gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze in der Euro-Zone", sagte der Chefvolkswirt des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Dierk Hirschel. "Das ist der Einstieg in den Abstieg, weil es die EZB dabei nicht belassen wird."
Die Wirtschaft reagierte dagegen mit Verständnis auf die erste Zinserhöhung der EZB seit mehr als einem Jahr. "Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank mag unbequem sein, ist aber notwendig und richtig“, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Jürgen Thumann. Das Preisklima im Euro-Raum habe sich zuletzt durch massive Verteuerung von Energie und Nahrungsmitteln dramatisch verschlechtert. Da könne die EZB nicht tatenlos zusehen. "Der Zinsschritt ist auch als unmissverständliche Warnung an die Tarifparteien zu verstehen, keine neue Lohn-Preisspirale loszutreten."
Geteiltes Bankenecho
Auch in der deutschen Bankenbranche stieß der EZB-Schritt auf ein unterschiedliches Echo. Während Privatbanken und Sparkassen den Beschluss begrüßten, äußerten sich die Genossenschaftsbanken zurückhaltender. Die Erhöhung sei vertretbar, aber nicht zwingend, erklärte der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Eine straffere Geldpolitik sei erst dann nötig, wenn es deutliche Zeichen für eine Abkehr von der moderaten Lohnpolitik im Währungsraum gebe. Dies sei nicht zu erkennen. Die Ursachen für die hohe Inflation lägen außerhalb der Euro-Zone und zwar vor allem in der starken Energienachfrage der Schwellenländer.
Der Bankenverband als Vertretung der Privatbanken nannte den Schritt dagegen notwendig, um die Inflationserwartungen rechtzeitig zu dämpfen. "Das Risiko einer Stagflation, wie sie von vielen derzeit befürchtet wird, kann nicht mit einer laschen Haltung gegenüber der Inflation beseitigt werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Manfred Weber. Auch Sparkassen-Präsident Heinrich Haasis sprach von einer richtigen Entscheidung. "Die EZB hat damit deutlich gemacht, dass sie die derzeit hohen Preissteigerungsraten in Europa nicht auf Dauer hinnehmen wird“, erklärte der Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.
Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Norbert Walter, erklärte im Hessischen Rundfunk, durch höhere Zinsen werde das Sparen attraktiver. Auf diese Weise habe man eine Perspektive, dass die Inflationsrate nicht auf diesem hohen Niveau bleibe. Einen möglichen Dämpfer für die Wirtschaft müsse man dabei akzeptieren.