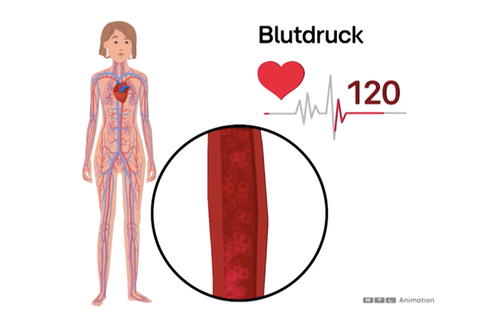Viele Menschen haben große Angst vor einem langsamen, unwürdigen Sterben. Gerade die aktuelle Diskussion um eine aktive Sterbehilfe zeigt, dass die lebensverlängernden technischen Möglichkeiten der modernen Medizin die Furcht vor dem Sterben nicht gemildert, sondern sogar noch vergrößert haben. Schriftliche 'Patientenverfügungen' spielen deshalb eine immer wichtigere Rolle.
Genauso groß wie die Angst vor dem Sterben ist auch die Verunsicherung über die Möglichkeit, rechtzeitig einen genauen Plan der 'Do's' und 'Dont's' für den medizinischen Notfall zu treffen. Dabei ist der Eintritt eines solchen Notfalls gar nicht so unwahrscheinlich - sei es, weil man im Koma liegt, an einer psychischen Krankheit leidet oder schlicht das Alter zum Verlust der Entscheidungsfähigkeit geführt hat. Dennoch wirken die medizinische Fachsprache und der erwartete große Informations- und Behördenaufwand abschreckend. Gelegentlich wird die Befürchtung laut, dass der Wunsch, schnell und schmerzlos zu sterben, in Zeiten von Kostendruck und Organmangel von behandelnden Ärzten ausgenutzt werden könnte, dass zu früh auf Behandlung verzichtet wird.
Was hat es also mit einer Patientenverfügung auf sich?
Grundsätzlich unternehmen Mediziner alles mögliche, um Leben zu erhalten und Krankheiten zu behandeln - dazu sind sie verpflichtet. Behandlungen müssen jedoch vom Patienten gewünscht sein, erst seine Einwilligung lässt den Arzt formaljuristisch keine Körperverletzung begehen. Eine Ausnahme davon kann nur in einer akut bestehenden Notfallsituation gelten, nicht jedoch für eine längere Behandlungsdauer. Ärzte können nicht einfach nach eigenem Ermessen Behandlungen vornehmen, einschränken oder beenden, wenn dies nicht auf dem erklärten oder mutmaßlichen Patientenwillen beruht. Ist nun aber der Patient nicht mehr in der Lage seine Zustimmung zu geben, ist der behandelnde Arzt entweder auf Hinweise von Bekannten des Patienten, wie dieser seine Behandlung gewünscht hätte, angewiesen oder er wird zu den medizinisch üblichen Maßnahmen greifen.
Dies soll eine Patientenverfügung regeln
An dieser Stelle setzt die Patientenverfügung ein: In ihr kann geregelt werden, welche Vorstellungen man von seiner Behandlung und auch von ihren Grenzen in Fällen schwerer und aussichtsloser Erkrankung hat. Sie richtet sich an Ärzte und Pflegepersonal und teilt ihnen die Wünsche des Patienten, der sich nicht mehr selbst äußern kann, mit. Das kann also seine Einwilligung darstellen oder klar machen, dass der Patient – wäre er bei Bewusstsein – einem Teil der lebensverlängernden Behandlung eben nicht zustimmen würde. Damit existiert ein stärkerer Anhaltspunkt für den Willen des Kranken als Aussagen von Freunden und Angehörigen es sind; und für den Arzt somit auch eine bessere Basis, sollte es zu einer gerichtlichen Überprüfung seiner Vorgehensweise kommen.
Verbindlich ist die Patientenverfügung für den Mediziner allerdings nicht - er muss trotzdem für jede Situation überprüfen, ob der Patient sie sich genau so vorgestellt hat, als er bestimmte medizinisch Möglichkeiten ausschloss oder ob er in Kenntnis bestimmter Umstände sich doch anders entschieden hätte.
Mehr Informationen
Patientenverfügung, Versorgevollmacht und Betreuungsverfügung ist Vorsorge für den Fall der Fälle. Über die Tragweite solcher Anweisungen sollte man sich jedoch im Klaren sein. Informationen bietet für 4,80 Euro Abholpreis der Ratgeber "Patientenverfügung" der Verbraucherzentralen. Bestellung per Telefon:
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, 06131/ 28 48 44
Website
Mit dem Hausarzt aufsetzen
Meist geht es bei einer Patientenverfügung um die Begleitung des Sterbeprozesses, genauer gesagt um zwei Aspekte.
- Einer davon ist die Frage, ob auf bestimmte Maßnahmen und eine lebensverlängernde Behandlung verzichtet werden soll.
- Der zweite Aspekt ist die sogenannte 'Pallativbehandlung', also die Frage, ob die Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten gewünscht ist, auch wenn diese die Nebenwirkung eines schnelleren Todeseintritts haben.
Der Wille des Patienten tritt umso klarer zu Tage - und wird daher umso mehr berücksichtigt - je individueller seine Verfügung ist. Ein nur unterschriebenes Standardformular kann auf viel Skepsis stoßen. Ein handschriftlicher Text hingegen, der so genau wie möglich aufschlüsselt, was gewollt und was nicht gewollt ist, stellt sicher, dass dem Verfasserwillen Rechnung getragen wird. Eine gründliche medizinische Aufklärung im Vorfeld macht Sinn, weswegen die Patientenverfügung zusammen mit dem eigenen Hausarzt aufgesetzt werden sollte. Niemand kennt den Kranken besser als der Arzt seines Vertrauens. Er kann auch als Zeuge das ordnungsgemäße Aufsetzen der Patientenverfügung unterschreiben.
Wenig Formvorschriften zu beachten
Grundsätzlich sind wenig Formvorschriften für diese Art der Absicherung zu beachten. Zum Beispiel ist nicht, wie gerne behauptet, eine notarielle Beurkundungen nötig. Der Text sollte möglichst handgeschrieben sein, also nicht nur ein ausgefülltes Formular. So wird deutlich, dass es sich um eine bewusst getroffene Entscheidung handelt. Unterschrift und Datum müssen allerdings sein.
Zeugen können ebenfalls unterschreiben und bestätigen, das zum Zeitpunkt der Abfassung keine Zweifel an der Urteilsfähigkeit des Patienten bestanden - dafür kommen besonders der Hausarzt oder eine Vertrauensperson, die sich im Fall des Falles auch um andere Angelegenheiten des Kranken kümmern würde, in Frage. Zur Durchsetzung der Patientenverfügung kann es hilfreich sein, diese Vertrauensperson mit einer Vorsorgevollmacht damit zu beauftragen, die Patienteninteressen wahrzunehmen.
In regelmäßigen Abständen wieder durchlesen
Sinnvoll ist es, die Patientenverfügung in regelmäßigen Abständen noch einmal durchzugehen, sich über aktuelle medizinische Entwicklungen zu informieren und getroffene Entscheidungen immer wieder zu überprüfen. Dieser kontinuierliche Erneuerungsprozess dokumentiert auch, dass alle Entscheidungen tatsächlich überlegt getroffen wurden. Das macht Situationen, in denen sich eine gewählte Vertrauensperson beispielsweise mit den Ärzten im Krankenhaus über den Fortgang der Behandlung auseinandersetzen muss, für beide Seiten einfacher.
Es reicht in der Regel völlig, wenn diese Aktualisierungen ungefähr alle zwei Jahre erfolgen, zusätzlich vor Operationen oder zu Beginn schwerer Erkrankungen. Das Dokument sollte entweder an eine Vertrauensperson ausgehändigt, beim Arzt hinterlegt oder bei sich getragen werden. Trägt man das Dokument nicht mit sich herum, so sollte, beispielsweise zusammen mit der Chipkarte der Krankenkasse, ein Hinweis vorhanden sein, dass eine solche Verfügung besteht und wo sie sich befindet.
Folgende Punkte sollten geregelt werden:
| 1. | Vertrauenspersonen, die in Ihrem Sinne mitentscheiden sollen und denen gegenüber Sie die Ärzte von ihrer Schweigepflicht entbinden |
| 2. | Eingriffe und Maßnahmen, die Sie generell ablehnen oder die auf jeden Fall durchgeführt werden sollen, wie Wiederbelebung, Sondenernährung, medizinische Apparate |
| 3. | Höhe der Erfolgsaussichten, bei denen Sie einer Behandlung noch zustimmen würden |
| 4. | Umstände für die Feststellung der medizinischen Voraussetzungen vor Anwendung der Patientenverfügung - ein Arzt, zwei Ärzte, Arzt, der selbst nicht an der Behandlung beteiligt war |
| 5. | Umstände, ohne die das Leben für Sie nicht mehr lebenswert wäre |
| 6. | Persönliche Einstellung zur Organspende nach dem Tod |
| 7. | Vorstellung davon, wie Sie gepflegt werden möchten, sollten Sie pflegebedürftig werden |
| 8. | Soll der Tod lieber ohne Bewusstsein oder bei Bewusstsein stattfinden |
| 9. |