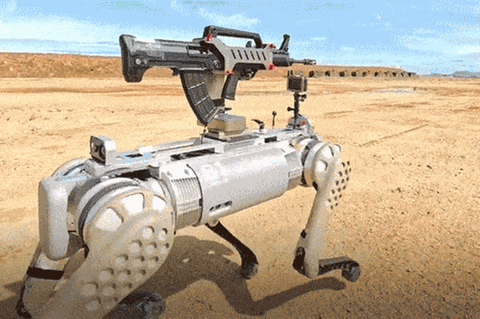Am Eingang des neuen Ladens im indischen Bangalore steht eine Platzanweiserin, um die Gäste zu begrüßen. Die humanoide Empfangsdame begleitet die Kunden ins Restaurant und beantwortet sämtliche Fragen – während sie jene Merkmale registriert, anhand derer sie ihre Gäste beim nächsten Besuch wiedererkennen kann. Sie weist ihnen Tische zu, danach müssen die Kunden selbst aktiv werden. Mit Tablets versorgt, können die Gäste auf der elektronischen Speisekarte auswählen, welches Gericht ihnen an den Platz gebracht werden soll.
Nach der Zubereitung der Mahlzeit erscheinen sie dann: die mit weiblicher Figur ausgestatteten Roboter, die das Essen servieren. Ihr Gesicht in aparter Form mit roten Leuchtdioden, die Augen simulieren. Ein fesches Halstuch nach vorn geknotet, das sie an Stewardessen erinnern lässt. Darunter ein Körper mit den Proportionen einer zarten Frau, inklusive Brüsten, schlanken Armen, einem langen Rock und farblich abgesetzter Schürze.

Die Platzanweiserin erkennt die Gäste – wenn diese zustimmen
Früher wäre es Teil eines Science-Fiction-Films gewesen: Humanoide Gestalten, die exakt wissen, was sie zu tun haben. Auf mit magnetischen Sensoren ausgestatteten Matten rollen die Kellnerinnen über die Restaurantgänge und folgen ihren unsichtbaren Aufträgen. Welchen Tisch sie bedienen werden, wurde ihnen vorher zugewiesen (also programmiert).
Was wie eine Sache der Höflichkeit wirkt, ist aber ebenso eine Frage des Datenschutzes. Kailash Sunder Rajan, General Manager der Franchise-Kette, erklärt: "Mit Gesichtserkennung ausgestattet, kann sie die Menschen beim nächsten Mal mit ihren Namen begrüßen. Natürlich macht sie das nur, wenn es ihr erlaubt wird."
Ganz lustig anzusehen und auszuprobieren wäre das, wenn man sich nicht gleichzeitig fragen müsste: Wozu brauchen Roboter ein Geschlecht? Warum diese überzeichnete feminine Figur? Gibt es jetzt etwa auch noch Maschinen-Sexismus? Und ganz sicher ist auch diese Frage offen: Als was arbeiten jene Kellner und Kellnerinnen aus Fleisch und Blut, wenn dieses Konzept Schule macht?
Quelle: "Metro"