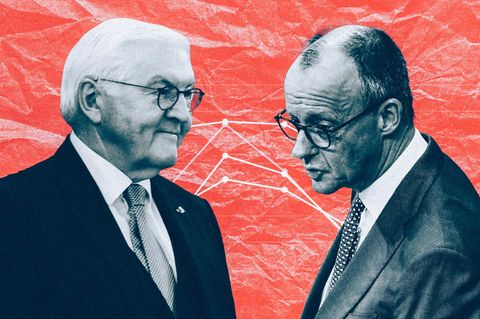Besonders die Gesundheitsreform wird nachhaltige Veränderungen bringen: Finanzierung, Organisation, und das Verhältnis von gesetzlicher zu privater Krankenversicherung werden neu gestaltet. Die Bundesregierung hofft, mit dieser Reform sicherzustellen, dass auch in Zukunft alle Bürger medizinisch versorgt werden.
Tatsächlich sind zum ersten Mal mit einer Gesundheitsreform weder verschärfte Zuzahlungsregelungen noch Einschnitte bei den Leistungen verbunden. Deshalb glauben die Kritiker des Reformwerkes auch, dass sich an der finanziellen Schräglage des Gesundheitswesens nichts geändert wird und erwarten zum Jahresende eine erneute Diskussion über die dann auftretenden Defizite.
stern.de gibt einen Überblick der Neuerungen ab dem 1. April.
spi
Gesundheitsreform
Für Träger von Kinderhospizen gibt es finanzielle Verbesserungen. Impfungen und Vater-/Mutter-Kind-Kuren sind Pflichtleistungen. Bei Arzneimitteln wird eine Kosten-Nutzen-Bewertung eingeführt. Besonders teure Medikamente werden nur noch verordnet, wenn der behandelnde Arzt zuvor eine ärztliche Zweitmeinung eingeholt hat. Die Abgabe von Einzeltabletten wird möglich.
Mehr Verantwortung für Versicherte
Die betriebliche Gesundheitsförderung wird gestärkt. Die Übergänge vom Krankenhaus in die Rehabilitation und Pflege werden verbessert. Die häusliche Krankenpflege in Wohngemeinschaften und anderen neuen Wohnformen wird erstattungsfähig. Neu ist auch, dass die Versicherten mehr Verantwortung tragen. Sie müssen sich an den Folgekosten für medizinisch nicht indizierte Maßnahmen, wie zum Beispiel Tattoos, Piercings und Schönheitsoperationen finanziell beteiligen.
Der flächendeckende Ausbau der Integrierten Versorgung wird gefördert. Hierbei erhalten Krankenkassen die Möglichkeit, ihren Versicherten eine abgestimmte Versorgung anzubieten. Dabei wirken Haus- und Fachärzte, ärztliche und nichtärztliche Leistungserbringer, ambulanter und stationärer Bereich und auch Apotheken koordiniert zusammen. Die Pflegeversicherung wird in die Integrierte Versorgung eingebunden.
Mehr Wahlmöglichkeiten
Es gibt deutlich erweiterte Wahlmöglichkeiten für die Versicherten. Die Krankenkassen müssen ab 1. April 2007 Tarife für die Teilnahme der Versicherten an folgenden besonderen Versorgungsformen anbieten:
Integrierte Versorgung,
besondere ambulante ärztliche Versorgung,
strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten (Disease-Management-Programme),
Modellvorhaben und
hausarztzentrierte Versorgung.
Wer als Versicherter an einer besonderen Versorgungsform teilnehmen will, bekommt einen Wahltarif angeboten. Die Entscheidung ist freiwillig. Im Wahltarif kann die Kasse vorsehen, dass die Versicherten entweder eine Prämienzahlung oder Zuzahlungsermäßigungen für die Teilnahme erhalten.
Die Kassen können außerdem anbieten:
Selbstbehalttarife,
Tarife für Nichtinanspruchnahme von Leistungen,
Variable Kostenerstattungstarife und
Tarife, die eine Kostenübernahme für von der Regelversorgung ausgeschlossene Arzneimittel von besonderen Therapieeinrichtungen beinhalten.
Bei "Selbstbehalttarifen" verpflichtet sich das Mitglied, einen Teil der Behandlungskosten selbst zu übernehmen. Im Gegenzug kann das Mitglied von seiner Kasse eine im Wahltarif vereinbarte Prämie erhalten. Bei "Tarifen für Nichtinanspruchnahme von Leistungen" nehmen das Mitglied und seine Familienversicherten ein Jahr lang keine Leistungen der Kasse in Anspruch. Auch hier erhält das Mitglied dafür eine Prämie. Diese ist begrenzt auf ein Zwölftel seines Jahresbeitrages.
Neue Mindestbindungsfrist
Für alle Tarife, die die Kasse freiwillig anbieten kann, gilt eine Mindestbindungsfrist von drei Jahren. Das heißt, die Versicherten legen sich für diesen Zeitraum auf einen solchen Tarif gegenüber ihrer Krankenkasse fest. Die Krankenkasse kann vor Ablauf dieser Zeit auch nur in Härtefällen gewechselt werden.
Detaillierte Informationen zur Gesundheitsreform hat das Bundesgesundheitsministerium unter www.die-gesundheitsreform.de veröffentlicht.
Nachrüstung von Diesel-Pkws
Steuerbefreiung von 330 Euro bietet einen Anreiz, in alte Diesel-Pkw moderne Filtertechnik einzubauen. Die Steuergutschrift deckt etwa 50 Prozent der Nachrüstungskosten von durchschnittlich 600 Euro. Die Zulassungsstellen melden den Finanzämtern die Nachrüstung. Damit entfällt eine eigene Schlüsselnummer in den Fahrzeugpapieren.
Nachrüstung bis Ende 2009 möglich
Generell werden Nachrüstungen vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2009 gefördert. Beim Wechsel des Fahrzeughalters soll der neue Eigentümer eine noch nicht abgelaufene Steuerbefreiung übernehmen können. Fahrzeughalter, die ihren Diesel (Erstzulassung vor dem 1. Januar 2007) bereits im Jahr 2006 nachgerüstet haben, erhalten die Steuerbefreiung rückwirkend. Sie wird jedoch erst gewährt, wenn die Kfz-Zulassungsstelle die technische Nachrüstung festgestellt hat und gilt nur so lange, bis der Betrag von 330 Euro erreicht ist.
Die deutsche Automobilindustrie hat zugesagt, alle neuen PKW spätestens ab Ende 2008 beziehungsweise Anfang 2009 mit einem Dieselpartikelfilter auszurüsten. Es werden keine bestimmten Filtertechniken gefördert. Vielmehr geht es darum, technikneutrale Anreize zu schaffen - für Fahrzeuge mit einem möglichst geringen Partikelausstoß. Die technischen Anforderungen sind in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung geregelt. Technische Lösungen, die den empfohlenen Grenzwert einhalten, sind bereits vorhanden.
Ohne Nachrüstung steigt die Kfz-Steuer
Für nicht nachgerüstete Fahrzeuge (Erstzulassung vor dem 1. Januar 2007) und Neuwagen ohne Filter wird die Kfz-Steuer erhöht: um 1,20 Euro je 100 Kubikzentimeter Hubraum. Das gilt auch für Wagen der Euro-4-Abgasnorm, sofern sie nicht den Partikelgrenzwert von 0,005 g/km der geplanten Euro-5-Norm einhalten. Dieser Zuschlag wird bei der Gegenfinanzierung der Steuerbefreiung helfen. Da den Ländern das Aufkommen aus der Kfz-Steuer zusteht, hätten sie ansonsten große Steuerausfälle.
Befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft
Zeitlich befristete Forschungsprojekte gehören weltweit zum Karriereweg von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mit dem neuen "Gesetz zur Änderung arbeitsrechtlicher Vorschriften in der Wissenschaft" werden die bisherigen Möglichkeiten für die Befristung eines Arbeitsvertrags erweitert. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs werden attraktive und international wettbewerbsfähige Arbeitsbedingungen geschaffen.
Neu: Beschäftigung in Drittmittelprojekten
Dazu zählt auch die Beschäftigung in Drittmittelprojekten. Bisher gab es nur Sonderregelungen für die Qualifizierungsphase von Wissenschaftlern. Nach dem neuen Gesetz ist auch nach dieser Zeit eine befristete Weiterbeschäftigung im Rahmen von Drittmittelprojekten möglich. Damit wird für die Beschäftigten die nötige Rechtsicherheit und für die Hochschulen und Forschungsinstitute ein hohes Maß an Flexibilität geschaffen. Die neuen Befristungsregelungen werden zusätzlich um eine familienpolitische Komponente ergänzt: Bei Betreuung von Kindern verlängert sich die zulässige Befristungsdauer in der Qualifizierungsphase um zwei Jahre je Kind. Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung, voraussichtlich Anfang April in Kraft.
Saison-Kurzarbeitergeld im Gartenbau
Zum 1. Dezember 2006 wurde das so genannte Saison-Kurzarbeitergeld eingeführt. Damit wird einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Wintermonaten entgegen gewirkt: Das neue Leistungssystem schafft die Grundlagen dafür, Arbeitnehmer bei saisonbedingten Arbeitsausfällen in den Wintermonaten fortzubeschäftigen. Entlassungen und Winterarbeitslosigkeit können seitdem im Bauhauptgewerbe und Dachdeckerhandwerk stärker vermieden werden.
Regeln greifen mit der nächsten Schlechtwetterzeit
Zum 1. April werden die Grundlagen für die vollständige Einbeziehung des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus in das Saison-Kurzarbeitergeldsystem geschaffen. Sie greifen ab der kommenden Schlechtwetterzeit, beginnend am 1. Dezember 2007. Bisher galt eine Übergangsvorschrift, nach der Betriebe der Branche Saison-Kurzarbeitergeld unter den ungünstigeren Bedingungen der alten Winterbauförderung zahlen konnten.
Schutz vor Fluglärm
Zum 1. April tritt die Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm, das aus dem Jahr 1971 stammt und seither nahezu unverändert geblieben ist, in Kraft. Menschen mit Wohnsitz in der Umgebung von größeren zivilen und militärischen Flugplätzen werden damit deutlich besser vor Fluglärm geschützt. Damit soll ein Ausgleich zwischen den Ansprüchen der Luftfahrt einerseits, und den berechtigten Lärmschutzinteressen der betroffenen Flugplatzanwohner andererseits erreicht werden.
Endlich auch Nacht-Schutzzonen
Bei der deutlichen und durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte für die Schutzzonen um 10 bis 15 Dezibel wurde der aktuelle Stand der Lärmwirkungsforschung berücksichtigt. An Flughäfen mit relevantem Nachtflugbetrieb müssen erstmals auch spezifische Nacht-Schutzzonen festgelegt werden. Ziel ist es, die von Nachtfluglärm betroffenen Menschen vor Schlafstörungen zu schützen.
Umweltverträglichkeit von Waschmitteln
Das neue Wasch- und Reinigungsmittelgesetz dient dem Umweltschutz und verbessert zugleich den Gesundheitsschutz der Verbraucher beim täglichen Umgang mit Wasch- und Reinigungsmitteln verbessern. Die bislang in Deutschland geltenden Vorschriften werden an EU-Recht angepasst.
Auch Seife muss biologisch abbaubar sein
Im Gegensatz zum bisherigen Recht dürfen nur noch Wasch- und Reinigungsmittel auf den Markt gebracht werden, deren waschaktive Substanzen vollständig biologisch abbaubar sind. Dies gilt zum Beispiel für Seifen.
Außerdem werden für mehr Verbraucherschutz die Vorschriften für die Kennzeichungspflicht von Waschmitteln erweitert. Diese betreffen vor allem die Informationen auf den Verpackungen zu den potenziell Allergie auslösenden Duftstoffen.
Deutsch-Polnische Vereinbarung über Umweltverträglichkeitsprüfung
Grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfungen tragen dem Umstand Rechnung, dass mögliche Umweltauswirkungen eines Projektes sich nicht auf ein Staatsgebiet begrenzen lassen. Das Verfahren sieht vor, die Öffentlichkeit im Rahmen einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung zu beteiligen. Dies sorgt für Transparenz und ist Voraussetzung dafür, Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Die grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gilt für alle geplanten Industrieanlagen und Großvorhaben wie Verkehrsprojekte, die nach nationalem Recht einer UVP bedürfen und Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben können.