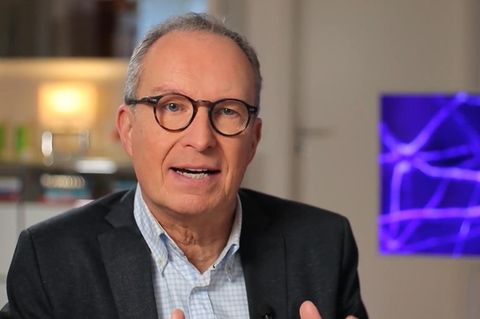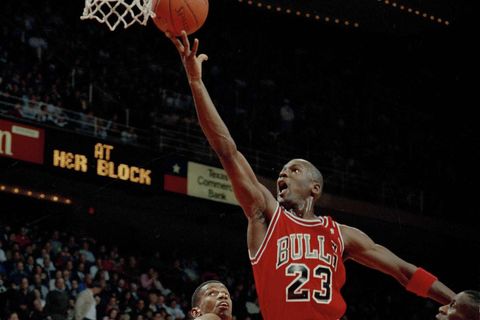Ambulanter Entzug
Schlaf- und Beruhigungsmittel: Nur wenn es ein stabiles Umfeld, keine weitere Abhängigkeit (z. B. von Alkohol) sowie keine schwerwiegende andere psychische Erkrankung gibt, ist zum ambulanten Verfahren zu raten. Nötig ist dann ein damit erfahrener Arzt. Ihn kann der Hausarzt, eine Drogenberatungsstelle, die Suchtambulanz einer psychiatrischen Klinik oder ein niedergelassener Psychiater vermitteln. Der Patient braucht Ausdauer und Durchhaltevermögen, denn der ambulante Entzug dauert länger als der stationäre; die Dosis wird langsamer reduziert - mehrere Wochen bis über ein halbes Jahr.
Schmerzmittel: Die ambulante Behandlung ist nur bei leichteren Schmerzen aussichtsreich. Ein Versuch ist möglich, wenn Schmerzmittel mit nur einem Wirkstoff verwendet wurden, die Betroffenen ein stabiles privates Umfeld haben und keine schweren psychischen Begleiterkrankungen vorliegen. Ein Schmerztherapeut, Psychiater oder Neurologe kann den Entzug durchführen. Er dauert mindestens zehn Tage (bei frei verkäuflichen Mitteln) bis hin zu mehreren Wochen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist geringer als bei einer stationären Behandlung.
Kosten: Die Kosten für einen ambulanten Entzug übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung.
Stationärer Entzug
Schlaf- und Beruhigungsmittel: Er wird von jeder psychiatrischen Abteilung oder psychiatrischen Klinik angeboten und dauert etwa drei bis sechs Wochen. In der Regel findet die Behandlung auf einer Alkoholentzugsstation statt. Bundesweit einmalig ist das von der Landschaftsverband- Westfalen-Lippe-Klinik Lippstadt angebotene Verfahren mit einer eigenständigen Behandlung für Medikamentenabhängige.
Schmerzmittel: Psychiatrische und neurologische Kliniken bieten einen stationären Entzug an, am meisten Erfahrung jedoch haben ausgewiesene Krankenhäuser wie die Landschaftsverband-Westfalen- Lippe-Klinik und die Schmerzklinik Kiel. Die Behandlung dauert in Kiel in der Regel acht bis zwölf Tage. Die stationäre Behandlung hat vor allem den Vorteil, dass Entzugs- und Begleiterscheinungen durch entsprechende Therapien effektiv abgefangen werden können. Außerdem kann der Patient gleichzeitig bezüglich der zugrunde liegenden Schmerzkrankheit optimal eingestellt werden - sowohl verhaltensmedizinisch als auch medikamentös. Zudem ist die Entlastung vom beruflichen und familiären Umfeld gerade bei psychischen Begleiterkrankungen für den nachhaltigen Erfolg wesentlich.
Kosten: Auch der stationäre Entzug wird von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Voraussetzung ist die Einweisung durch einen Arzt.
Medikamente während des Entzugs
Beim Schlaf- bzw. Beruhigungsmittelentzug: Der Konsum wird in der Regel schrittweise reduziert. Das passiert entweder mit dem bisherigen Mittel, oder der Arzt stellt auf ein anderes Präparat aus dieser Substanzgruppe um, das eine günstigere Wirkdauer hat und genauere Dosiermöglichkeiten für kleine Reduktionsschritte bietet. Gelegentlich werden die Medikamente auch schlagartig abgesetzt. Insbesondere dann wird ein Mittel gegeben, das vor epileptischen Anfällen schützt, die bei einem plötzlichen Ausbleiben des Wirkstoffes auftreten können. Auch bei der langsamen Reduktion werden solche Medikamente häufig verabreicht. Denn sie wirken zudem gegen Entzugserscheinungen wie Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Unruhe und Schlafstörungen. Als ergänzende Maßnahmen haben sich unter anderem Entspannungsverfahren und Verhaltenstherapie bewährt.
Beim Schmerzmittelentzug: Das Medikament wird - etwa wenn es Kopfschmerz auslöst - nicht ausgeschlichen, sondern unmittelbar abgesetzt. Durch andere Mittel, gegebenenfalls über eine Infusionstherapie, lassen sich Entzugserscheinungen abfangen, etwa Übelkeit, Erbrechen oder erneuter, durch die Umstellung bedingter Kopfschmerz.
Entwöhnungstherapie
Nach dem Entzug von Schlaf- und Beruhigungsmitteln: Manche Patienten benötigen im Anschluss an den eigentlichen Entzug eine klassische psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung. Oft leiden sie unter einer Depression oder Angststörung. Häufig war auch eine psychosomatische Erkrankung der Auslöser für die Medikamentenabhängigkeit. Diese Grunderkrankung muss dann durch eine psychosomatische Therapie angegangen werden. Oft wird eine solche Therapie schon während des stationären Entzugs angeboten und begonnen. Für die ambulante Nachsorge sollten Sie darauf achten, dass der weiterbehandelnde Arzt oder Therapeut Erfahrung in der Behandlung Suchtkranker hat. Eine Nachsorgetherapie wird in der Regel erst nach Antragstellung finanziert, und zwar durch den Rentenversicherungsträger oder die gesetzlichen Krankenkassen. Die Kosten für eine psychiatrische Behandlung werden immer übernommen.
Nach dem Schmerzmittelentzug: Eine psychotherapeutische Nachbetreuung ist dann erforderlich, wenn der Umgang mit chronischen Schmerzen erlernt werden muss oder soziale Schmerzauslöser bekannt sind - wie eine hohe Arbeitsbelastung oder Beziehungsprobleme. In jedem Fall sollte der Patient etwa ein Jahr lang von einem niedergelassenen Arzt begleitet werden.