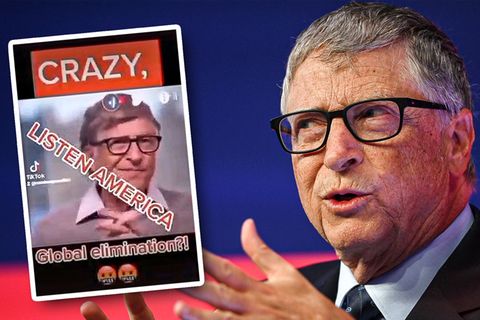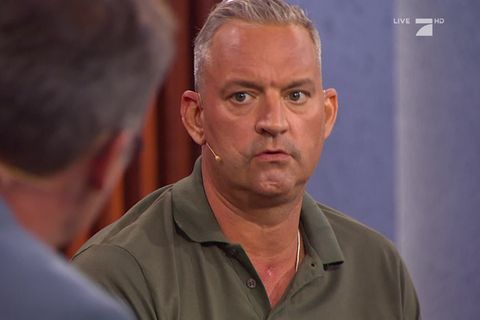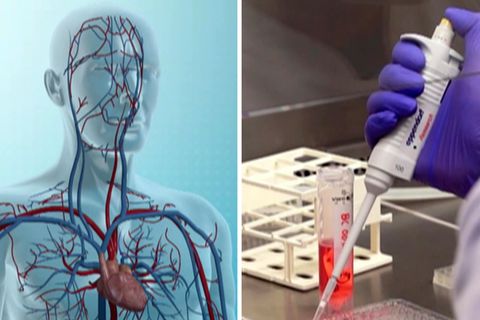Plötzlich kann man den Partner nicht mehr riechen, das Essen schmeckt bloß noch nach Einheitsbrei. Die Riechstörung zählt zu den häufigsten Symptomen einer Covid-19-Erkrankung. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) leidet etwa jeder Fünfte (19 Prozent) nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 an einer Störung des Geruchs- und/oder des Geschmacksinns. Eine Zahl, die aufgrund der Art der Erfassung wahrscheinlich zu niedrig angesetzt ist. So gibt es eine Reihe von Studien, die davon ausgehen, dass mehr als jeder zweite Infizierte zumindest zeitweise mit einer solchen Störung zu tun hat. Manche können auch nach Monaten nicht wieder richtig riechen und schmecken.
Die Störung des Geruchssinns ist in der Medizin ein bekanntes Phänomen, das auch bei anderen viralen Infektionskrankheiten auftreten kann. Doch bei Covid-19 scheinen andere Mechanismen zu greifen als eine verstopfte Nase. So kam ein Forscherteam der Harvard Medical School bei der Analyse solcher Fälle zu dem Ergebnis, dass bestimmte Zelltypen in der oberen Nasenhöhle besonders anfällig für eine Infektion sind.
Sie konnten das Virus in sogenannten Stützzellen, welche die Nervenzellen umgeben, nachweisen. Und die auf die Infektion folgende Immunreaktion könnte dazu führen, erklärten die Forscher, dass Gewebe anschwillt, die Riechzellen blieben aber intakt. Sobald die Schwellung abklingt, könne sich daher auch der Geruchssinn normalisieren. Bei der Schwere der Geruchsstörung spiele wohl auch der Grad der Entzündung eine Rolle.
Ist eine Verspannung die Ursache von Riechstörungen?
Doch was, wenn sich auch nach Monaten keine Besserung einstellt? Im Zentrum für Osteopathie in Coesfeld mehrten sich solche Fälle. Der Unfallchirurg und Osteopath Dr. Oliver Wirtz berichtet dem stern von mehr als 60 Patienten mit diesem Symptom. Viele Menschen, die in das Zentrum kämen, hätten bereits eine Ärzte-Odyssee hinter sich und die Hoffnung aufgegeben, dass ihnen geholfen werden könne. Das liege auch daran, dass Riechstörungen im Zusammenhang mit Covid-19 oftmals mehr als Schönheitsfehler angesehen würden, denn als ernsthaftes Problem. "Die Patienten werden oft missverstanden", sagt er. Dabei handele es sich um gravierende Einschränkungen.
Die Osteopathen machten sich auf die Suche nach dem Ursprung des Symptoms. Auch sie seien zunächst von einer Schwellung der Schleimhäute als Ursache ausgegangen, kamen dann aber zu einem ganz anderen Schluss. Osteopathen suchen Spannungen in Gewebe und Organen sowie Störungen in der Funktion, unter anderem indem sie den Schädel durch den Mundraum mit dem Finger ertasten. Dabei fanden sie bei allen Betroffenen eine Gemeinsamkeit. Bei allen, erzählt Wirtz, konnten sie eine Störung im vorderen Schädel-Basis-Bereich feststellen, eine Verspannung der Hirnsichel. "Wir gehen daher eher von einer mechanischen Störung aus", so Wirtz.
Die Hirnsichel trennt die beiden Gehirnhälften. Verspannt sie sich, kann das zu einer Blockade des Siebbeins, auch Riechbein genannt, führen. Solche Verspannungen sind beispielsweise aus der Unfallchirurgie bekannt. Sie können mitunter nach einem Schädel-Hirn-Trauma auftreten und in der Folge zu einer eingeschränkten Riechleistung führen. Die Osteopathen wollen nun einen Zusammenhang von Corona-Infekt und einer solcher Verspannung festgestellt haben. Was sie allerdings auslöst, ob es infolge der Infektion zu einer Schädigung der Membran kommt, ist unklar. Auch ein vorhergegangener Unfall könnte dabei eine Rolle spielen.
Osteopathischer Behandlungsansatz
Vermutlich verspanne sich die Hirnsichel und Dura Mater, also die harte Hirnhaut, während des viralen Akutinfektes, so Wirtz. "Ähnliche Befunde finden wir bei Chemotherapie-Patienten und Patienten mit Langzeit-Antibiotika-Gaben", sagt er. Nach Abklingen des Akutgeschehens bleibe diese Verspannung bestehen und schränke die Eigenbewegung des Siebbeins ein. Wirtz weiter: "In der Osteopathie bedeutet: 'eingeschränkte Beweglichkeit' auch eine eingeschränkte Durchblutung und Funktion des Organs; hier des Siebbeins und der Riechfasern, die in das Siebbein einstrahlen." Weitere wissenschaftliche Belege für die These der Osteopathen gibt es bislang nicht.
Professor Alessandro Bozzato ist Stellvertretender Direktor der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik des Universitätsklinikums des Saarlandes. Er ist skeptisch und sagt: "Natürlich machen virale Infekte eine Vielzahl an möglichen Symptomen. Muskuläre und skelettale Probleme sind sicherlich Bestandteil eines möglicherweise komplexen Beschwerdebildes. Eine direkte Beeinflussbarkeit von Schädel oder gar Nasennebenhöhlenstrukturen halte ich aber für sehr gewagt und entbehrt einer physiologischen Grundlage." Stressbedingte Verspannungen seien seiner Erfahrung nach aber ein wichtiger Punkt. "Dass hier Osteopathieverfahren hilfreich sind und das zentrale Nervensystem positiv beeinflussen können, liegt meiner Ansicht nach auf der Hand", so Bozzato.

Effekte nach der ersten Behandlung
Nach ihrer Entdeckung behandelten die Osteopathen in Coesfeld die Patienten mit dem Ziel, die Hirnsichel zu entspannen, das Riechbein von seiner Blockade zu befreien. Ein Ansatz, der laut Wirtz Erfolg zeigte. Ist die Mobilität erst einmal wieder hergestellt, die Verbindung zwischen Siebbein und Riechnerven wieder intakt, die Durchblutung wieder ohne Störung, stelle sich schnell eine Besserung ein. "Bei den meisten Patienten verbessert sich die Riechleistung bereits nach der ersten Behandlung um 50 Prozent", berichtet Wirtz.
Der osteopathische Ansatz sei einer von verschiedenen Therapiemöglichkeiten, so Wirtz. Ein Wundermittel ist aber auch diese Behandlung nicht. So hätten die Osteopathen zwar vielen, aber nicht allen helfen können. Bei zwei, drei habe die Behandlung nicht angeschlagen, so Wirtz. Dazu komme, dass auch nach Behebung der Störung Geduld gefragt ist. Es kann bis zu sechs Wochen dauern, bis ein Effekt spürbar ist. Förderlich bei der Reaktivierung der Sinne sei auch ein sogenanntes Riechtraining.
Solche führt Bozzato durch. Die Patienten besorgen sich dafür haushaltsübliche Duftstoffe. An diesen Duftstoffen riechen sie zwei- bis dreimal täglich etwa 20 Sekunden lang intensiv und bewusst. "Dadurch werden die Nervenzellen in der Nase aktiviert", erzählte Bozzato im stern-Interview. Leider könne man nicht vorhersagen, bei wem das gut funktioniert und zu welchem Ausmaß sich der Erfolg einstellt. "Es gibt leider Patienten, die sich nicht oder nur teilweise erholen. Manche benötigen nur wenige Wochen, andere viele Monate."