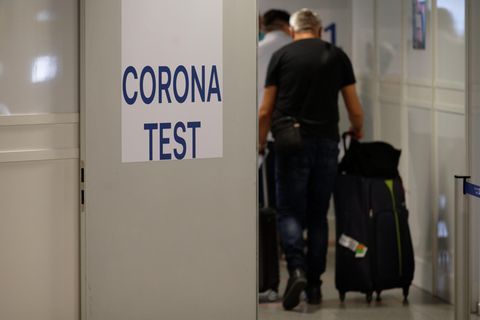Bloggerin Denise erinnert sich noch sehr genau daran, wie es anfing. Damals, mit dem Abitur, den Prüfungen und dem Stress. Immer wieder verloren sich ihre Hände in ihren kurzen Nackenhaaren, wenn sie allein am Schreibtisch saß. Sie zwirbelte und zog an den feinen Härchen, bis sie brachen. Das war vor gut acht Jahren und Denise gerade einmal volljährig. "Lange Zeit war mir nicht bewusst, dass ich das mache", sagt sie heute rückblickend. "Und lange wusste ich nicht, dass es überhaupt einen Begriff dafür gibt."
Trichotillomanie. Es ist ein ungemein stanziges Wort, das eine an sich einfache Handlung beschreibt: Haarerupfen – manchmal bis Stellen der Kopfhaut kahl sind. Andere Betroffene knibbeln an ihren Augenbrauen, ziehen an Wimpern oder reißen sich Körperhaare aus. Die Störung zählt laut der International Classification of Diseases ICD-10 zu den Störungen der Impulskontrolle. Dabei handelt es sich um Handlungen, die wiederholt und ohne vernünftige Motivation erfolgen.
Das Wort Trichotillomanie setzt sich aus drei griechischen Begriffen zusammen: "thrix", dem Haar, "tillein", rupfen, und "mania", dem Wahnsinn. Schätzungsweise jeder 200. Deutsche leidet darunter, genaue Zahlen existieren nicht. Viele Betroffene dürften auch nicht wissen, dass es sich dabei um eine eigenständige Störung handelt.
So war das zunächst auch bei Modebloggerin Denise, die in einem Youtube-Video über ihr Leben mit Trichotillomanie berichtet. Sie rupfe besonders in Stresssituationen an ihren Haaren, manchmal auch wenn sie alleine sei und Filme sehe. Und dennoch sei sie noch ein "harmloser Fall". Bei ihr äußere sich die Störung nämlich nur durch kurze Haare am Hinterkopf – und nicht etwa durch kahle Stellen wie bei anderen Betroffenen.
Trichotillomanie: Wenn Haarerupfen beruhigt
Laut Antonia Peters, der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen, seien das die typischen Momente, in denen Betroffene ihrem Zwang nachgingen, "nämlich dann, wenn sie Ruhe brauchen oder zur Ruhe kommen." Wie stark die jeweiligen Symptome ausfallen und wie häufig gerupft werde, sei individuell sehr verschieden: "Während sich einige ganze Haarbüschel ausreißen, zupfen sich andere ein, zwei Wimpern aus."
Im Vordergrund stehe dabei aber immer der Wunsch nach Regulation. "So wie andere anfangen, unter Stress zu essen oder die Nägel zu kauen, reißen sich Menschen mit Trichotillomanie die Haare aus." Dies verleihe ein gutes, ein beruhigendes Gefühl.
Das ist es auch, was das Haarereißen von anderen Zwangsstörungen, etwa übermäßigen Putz- und Waschzwängen unterscheidet. Sie sollen in erster Linie Ekel oder Ängste abwehren – etwa die Panik vor Keimen. Diese Befürchtungen sind bei Trichotillomanie nicht vorhanden. "Das Haarereißen dient in erster Linie der Entspannung", so Antonia Peters.
Wie die Störung entsteht, ist derzeit noch unklar. Es wird aber eine erbliche Vorbelastung diskutiert, da die Störung in einigen Familien gehäuft auftritt. Auch erlernte Verhaltensmuster, etwa der Umgang mit Belastungen, könnten eine Rolle spielen.
Haarereißen – ab wann krankhaft?
Doch wo hört ein normaler Spleen auf – und wo beginnt eine psychische Störung? Antonia Peters weiß, dass "die Übergänge oft fließend sind". Anzeichen können sein, wie sehr der Zwang den Alltag bestimmt, wie stark der Betroffene leidet oder sich eingeengt fühlt. Eine entsprechende Diagnose kann jedoch nur das Gespräch mit einem Psychotherapeuten liefern. Er entscheidet auch, ob eine ambulante Verhaltenstherapie notwendig ist. In dieser lernen Betroffene, mit Stresssituationen umzugehen und ihren Zwang nach und nach abzubauen.
Meist helfe es Betroffenen auch, "sich bewusst aus der Situation rauszunehmen", erklärt Peters. Unruhige Hände lassen sich etwa auf andere Gegenstände "umlenken". Statt an den Haaren zu friemeln, könne man etwa einen kleinen Gummiball kneten, sich auf die Hände setzen, den Raum verlassen oder sich anderweitig ablenken.
Bloggerin Denise jedenfalls hat ihren Weg gefunden, mit der Störung umzugehen: Ihr tue es gut, darüber zu reden, sagt sie. Sie hoffe nun, dass sie mit ihrem Bekenntnis auch anderen Betroffenen helfen kann.