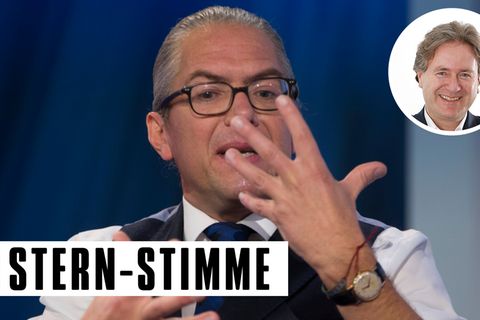Der Wind weht über den Bodensee, und Martin Walser seufzt. Wegen der Interviews, die er meist nicht mag, wenn er sie nachträglich liest. "Es schmerzt", sagt er mit bedächtig rollendem R. "Diese Fiktion der Sachlichkeit, das schmerzt." Er seufzt wieder. "Das ist natürlich nötig, ich weiß." "Dann fangen wir jetzt trotzdem an?" "Sicher, sicher."
Herr Walser, in Ihrem neuen Roman geht es um Goethe, der sich in Ulrike von Levetzow verliebt und ihr 1823 einen Heiratsantrag macht. Das ist tatsächlich so passiert - Goethe war damals über 70, besagte Ulrike gerade 19.
Wissen Sie, ich habe bis jetzt noch nie einen Romantext gehabt, der die Leute nicht zum Lachen bringt. Dieses Mal ist nichts zum Lachen. Ich habe morgens um fünf Uhr angefangen zu schreiben, und ich hatte sofort diesen Ton, der mich getragen hat. Acht Wochen habe ich geschrieben, und es lief und lief und lief …
Martin Walser
"Ein liebender Mann", Rowohlt, 288 Seiten,
19,90 Euro
Die Liebe zwischen einem alten Mann und einem jungen Mädchen - darüber haben Sie bereits häufiger geschrieben. Machen Sie Goethe jetzt zu Ihrem Gewährsmann?
Da drängt sich mir ein Wort auf, das ich aber nicht so meine: Es war eine Art Schadenfreude, als ich das geschrieben habe. Die vor allem weiblichen Kritiker, die mir die Bücher mit dem großen Altersunterschied übel vermerkt haben …
. . . Ihnen wurde wiederholt "Altersgeilheit" vorgeworfen . . .
… daher meine gewisse Schadenfreude. Die können mir das bei diesem Buch nicht vorwerfen.
Sie können schon. Es ist doch Ihr Roman.
Aber bitte schön, es ist Goethe! Unser größtes Stück! Und der liebt mit 73 eine 19-Jährige. Also schlimmer kann man's doch gar nicht bringen, in den Augen derer, die das angekreidet haben. Die gesagt haben, das sei biologisch, ästhetisch und moralisch verwerflich.
Auf diese Vorwürfe antworten Sie jetzt?
Ich antworte, weil es diese Vorwürfe nicht geben kann. Die haben ja gesagt, das sei peinlich, so ein Altersunterschied. Dabei war das nur denen peinlich. Mir nicht! Ich habe das Buch nicht deswegen geschrieben, aber es ist ein Umstand, von dem ich mir das Schönste erhoffe. Dass endlich Verständnis blüht! Für solche Unterschiede!
Vielleicht geht es gar nicht um Peinlichkeit. Sondern darum, dass sich bei Ihnen junge Frauen mit großer Selbstverständlichkeit in ältere Männer verlieben. Was ist so wichtig daran, für diese Art der Darstellung Verständnis zu bekommen?
Ach, Sie meinen, Unverständnis genügt? Ich liebe alle meine Helden gleichermaßen, und es schmerzt mich, wenn sie in die Welt kommen und da nicht geliebt werden.
Lieben Sie auch Ihre weiblichen Figuren?
Bei Gott, bei Gott. Also diese Frage hätten Sie wirklich nicht stellen dürfen. Ich will sie Ihnen nicht übel nehmen. Es hat mir ja keiner geglaubt, bei meinem Roman "Tod eines Kritikers", dass ich den Kritiker genauso liebe wie alle anderen Figuren. Und da sind natürlich, wenn Sie gestatten, Frauen eingeschlossen.
Aber als Schriftsteller sind Sie derjenige, der die Gefühlswelt dieser jungen Frauen ausmalt. Die wahre Ulrike von Levetzow hat ihr Leben lang abgestritten, dass es eine Liebesbeziehung zu Goethe gab.
Das möchten Sie gern: ein Leben lang! Das ist ganz und gar Ihre Erfindung.
In ihren Erinnerungen schreibt sie es. "Keine Liebe war es nicht", so die wahre Ulrike.
Und da war sie über neunzig, viel mehr ist von ihr nicht überliefert, das heißt, was wir da erfahren, kann für Goethe nicht der Anlass gewesen sein, die "Marienbader Elegie", das gewaltigste Liebesgedicht der deutschen Sprache, zu schreiben. Das heißt, Ulrike muss eine andere gewesen sein ...
. . . davon gehen Sie aus . . .
... und diese Ulrike habe ich aus Goethes Liebe und Goethes Schmerz gebildet.
Was in ihr vorgeht, erfahren wir kaum. Warum sollte sich ein 19-jähriges Mädchen verlieben in den über 70-jährigen Mann? Mich interessiert, wie Sie diese Gefühle begründen.
Er fühlt sich geliebt, nur darauf kommt es an.
Vielleicht bewundert das Mädchen den großen weisen Schriftsteller einfach nur? Und er interpretiert das als Liebe?
Sie bewundert ihn nur … hm … Und Bewunderung führt nicht weiter?
Er ist berühmt. Sie sonnt sich in seiner Gesellschaft. Himmelt ihn an. Sie ist 19!
Es macht ihr Spaß, mit ihm zu reden. Sie summiert nichts, sie analysiert nichts. Sie imitiert ihn ja auch. Also sie spielt.
Und das ist für Sie gleichbedeutend mit Liebe?
Spaß ist die Praxis. Die angewendete Liebe, wenn Sie so wollen.
Es mag ja ein Reiz bestehen, aus Sicht dieses Mädchens. Aber Liebe?
Gut, Sie stellen andere Ansprüche an Liebe. Sie dürfen sich da auch gern für typisch halten.
Um Ansprüche geht es nicht. Aber Sie schreiben es ja selbst: Das ist eine wissbegierige junge Frau, die etwas lernen will. Und ein älterer Mann, der ihr etwas beibringt. Das ist für Sie eine gleichberechtigte Liebesbeziehung? Ja. Das wird von außen verfügt, dass so ein Altersunterschied unanständig ist. So wie bei Desdemona und Othello die unterschiedliche Hautfarbe damals als unanständig galt.
Das ist dasselbe? Sie gehen davon aus, dass eine Frau, die noch zur Schule geht, einem über 50 Jahre älteren Mann an Souveränität ebenbürtig ist? Dass sie ebenso wie er Interesse an mehr hat, um es mal so zu sagen?
Das ist die Frage, ob sie ihm souverän begegnet. Das lernt sie. Sie lernt sehr schnell.
Eben. Bitte, es geht mir nicht um Moral. Und natürlich darf man in einem Roman alles schreiben. Was ich infrage stelle, ist die Gegenseitigkeit dieser Liebe, von der Sie ausgehen.
Sie meinen, zwei 30-Jährige können genauso unglücklich sein. Gut, das darzustellen habe ich auch schon versucht. Was mich angezogen hat, ist die grenzenlose Demonstration einer Liebe unter den unmöglichsten Bedingungen. Aber das ist jetzt auch ausgereizt, diese Karte spiele ich nicht mehr.
Dass es nur darum geht, unmögliche Bedingungen darzustellen, glaube ich nicht. Das könnten Sie auch anders machen. Junge Frau, alter Mann - das ist doch kein gesellschaftlicher Tabubruch, sondern das Fortschreiben einer Männerfantasie. Einer Männerhoffnung. Dass sie in jedem Alter Frauen kriegen. Und die Frauen dahinschmelzen beim ersten Bonmot, das der Mann von sich gibt . . .
Von meinem Roman reden Sie nicht.
Ich frage ja nur. Ob Sie verstehen, dass dieses Motiv amüsant wirkt, aus Frauensicht. Was Männer sich da so hinfantasieren.
Ihre hartnäckig generalisierende Ausdrucksweise zeigt, dass Sie nicht über meinen Roman reden wollen, sondern über das Allerweltsthema alter Mann, jüngere Frau. Ich muss aber zugestehen, dass ich für das Allerweltsthema nicht zuständig bin, ich bin zuständig für Goethe und Ulrike.
Aber um dieses Thema geht es doch auch, in diesem Roman, in dem Sie Goethe als "liebenden Mann" zeigen.
Ich zeige das größtmögliche Leid und die größtmögliche Illusion.
Der Roman endet, als Ulrike die Beziehung abbricht. Aufgrund gesellschaftlicher und familiärer Konventionen, wie Sie nahelegen. Goethe bleibt zurück und träumt von ihr. Als er aufwacht, hat er "sein Teil in der Hand, und das war steif". Wozu diese Information?
Er bleibt ihr in seinen Träumen ausgeliefert. Er hat den schlimmsten Schmerz, den man haben kann. Dieser Mann, mein Goethe, spielt der Welt einen Entsagenden vor. Aber innen verzichtet er nicht. Das Leiden ist absolut.
Die Frauenfigur in einem anderen Ihrer Romane hat ein anderes Konzept von Liebe. Sie sagt: "Liebe - bis jetzt hieß das immer auf sich selber verzichten." Denken Sie, dass Männer und Frauen anders lieben?
Es tut mir ja so leid, dass ich keine Auskunft sein kann für erotische Allerweltsprobleme. Aber aus purer Höflichkeit versuche ich zu antworten. Ich glaube, im Schmerz, im Leid und in der Sehnsucht gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau.
Ich finde nicht, dass meine Frage auf erotische Allerweltsprobleme abzielte. Kennen Sie Lieben in erster Linie als Leiden?
Meine Erfahrung sagt mir, es gebe weder Glück noch Unglück. Es gibt, glaube ich, nur Unglücksglück. Heute Morgen wollte ich in mein Tagebuch schreiben: Das Leben ist ein Stierkampf, bei dem du der Torero und der Stier bist.
Beides zu gleichen Teilen?
Ich kann mich nicht trennen in diese oder diese Rolle. Wenn ich mir anschaue, wie das Leben war, sag ich jetzt schon, dann war es das. Torero und Stier.
Interview: Andrea Ritter