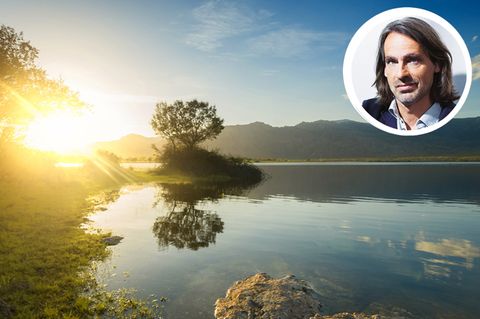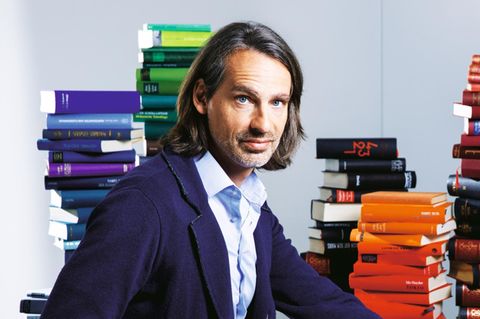Wenn ein junges Paar in Kaliningrad heiratet, dann bekommt auch Immanuel Kant Blumen. Ungefragt biegen die Fahrer der geschmückten Hochzeitskonvois am Moskauer Prospekt in Richtung Kneiphof-Insel ab. Dort, unter einer strengen Säulenhalle an der Nordwand des Domchores, liegt Kant (1724-1804) begraben. Die russischen Einwohner von Kaliningrad, früher Königsberg, verehren den deutschen Philosophen wie einen Landsmann. Auf dem stilisierten Sarkophag aus rotem Granit liegen immer frische Blumen. Am 12. Februar, wenn sich der Todestag Immanuel Kants zum 200. Mal jährt, werden viele Kränze und prächtige Blumengebinde dazukommen.
Die meisten der fröhlichen jungen Leute, die zum Grab des Gelehrten kommen, werden seine moralphilosophischen Kritiken nie lesen. Eher intuitiv begreifen sie Kant als eine Brücke zwischen dem alten Königsberg, Kaliningrad und einem aufgeklärten modernen Europa. "Immanuel Kant, das ist für mich Frieden und eine zivilisierte Gesellschaft", sagt Irina, eine Physiklehrerin.
Einst war Königsberg geistiges Zentrum Europas
Kant und und das postsowjetische Kaliningrad bilden ein seltsames Gespann. Der geniale Weltgelehrte machte die Stadt mit seiner revolutionären Erkenntniskritik zu einem geistigen Zentrum Europas. Dagegen habe das moderne Kaliningrad "im tragischen Spannungsfeld zwischen Geschichtsträchtigkeit und Geschichtslosigkeit, gefangen in seiner verdrängten und tabuisierten Vergangenheit, den Geist Kants ausgelöscht", klagt der Kulturwissenschaftler und bekennende Kantianer Wladimir Gilmanow.
Als Wegbereiter des Marxismus umgedeutet
In Kaliningrad erinnert kaum noch etwas an Kants Königsberg. Nach dem Krieg wurde das historische Stadtzentrum ausgelöscht, um Platz für das sowjetische Modell eines aufgeklärten Daseins zu schaffen. Das Grab des deutschen Philosophen überstand die Abrisswellen nur, weil er vereinnahmt wurde: Kant galt als Wegbereiter des Marxismus.
Doch weil die 1924 errichtete Stoa Kantiana an den Dom gebaut war, durfte auch die Ruine des Gotteshauses bleiben. Selbst Kaliningrads radikalste Kommunisten wagten es nicht, den von Parteichef Leonid Breschnjew erteilten Sprengbefehl auszuführen. «Kant hat den Dom gerettet» - so beginnen bis heute viele Erzählungen in Kaliningrad.
Viele Besucher im Kant-Museum
Inzwischen wird der Dom wiederaufgebaut. Im Turm mit der berühmten Wallenrodt-Bibliothek hat man ein Kant-Museum eingerichtet. Das Sammelsurium philosophischer Schriften, Gedenkplaketten und ein Abguss der Totenmaske Kants ziehen zehntausende Besucher an. Es sind Russen ebenso wie Deutsche. Für alte Ostpreußen gehört ein Besuch zum heimwehtouristischen Pflichtprogramm.
Erste russische Kant-Biografie
Die Rückbesinnung auf den Denker hat auch die Universität erfasst. Draußen steht wieder sein Denkmal, drinnen hat die Russische Kant-Gesellschaft ihren Sitz. Der "Kategorische Imperativ" ist Lehrstoff am neugegründeten Philosophischen Institut. Wer in Russland Kant studieren will, geht nach Kaliningrad - wie der Philosoph Wadim Kurpakow, der an der ersten umfassenden russischen Kant-Biografie arbeitet.
Historische Stätten aus Lebzeiten des "großen Einsamen zwischen zwei Epochen" ("Spiegel") indes gibt es in Kaliningrad nicht mehr. Kants Wohnhaus in der Prinzessinstraße wurde schon zu deutscher Zeit abgerissen. Auch das Gartenhaus von Oberförster Wobser in Moditten, bei dem Kant gern den Sommer verbrachte, ist verschwunden, selbst wenn manche Reiseführer das Gegenteil behaupten.
"Das moralische Gesetz in mir"
An einer Mauer, hinter der einst das 1968 gesprengte Königsberger Schloss aufragte, hängt wieder eine Gedenktafel mit Kants berühmtem Spruch aus der "Kritik der praktischen Vernunft": "Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir."
Drei Jahre als Hauslehrer
Im Kant-Gedenkjahr bereitet sich Kaliningrad auf viele Gäste vor. Nach Wjeselowka aber, 90 Kilometer östlich von Kaliningrad, dürfte sich kaum jemand verirren. Im Pfarrhaus des Dorfes, das zu deutscher Zeit Judschen hieß, arbeitete der junge mittellose Kant um 1750 drei Jahre als Hauslehrer, weil die Albertina-Universität ihm eine Anstellung verwehrte.
Das Pfarrhaus steht noch, ostpreußischer Backstein ist hart im Nehmen. Doch das Dach sackt zusammen, und in wenigen Jahren wird die verwahrloste Ruine verschwunden sein. Hier ist die Aufklärung längst am Ende. Der letzte Bewohner des Kant-Hauses hat von seinem berühmtem Vorgänger noch nie gehört: "Hier gibt es keine Philosophen. Nein, nicht dass ich wüsste."