Professor Wöllstein, der Apostroph beim Genitiv, volkstümlich auch der Deppen-Apostroph genannt, ist jetzt bei Eigennamen erlaubt. Hat der Rat der Rechtschreibung aufgegeben, weil es sowieso die Mehrheit falsch gemacht hat?
Nein! Was viele nicht wissen: Das abgetrennte Genitiv-s bei Eigennamen war schon vorher erlaubt. Es war nur nicht präzisiert worden, wann eine solche Schreibung in Ordnung ist und wann nicht. Wir haben also die Regel genauer gefasst. Damit der Kontext, in dem es abgetrennt werden darf, auch verständlich ist und das abgetrennte s nicht inflationär angewendet wird. In vielen Fällen ist und bleibt es aber falsch.
Also wenn Eva ihren Laden "Eva’s Backstube" nennt, dann ist das richtig und das war auch schon vorher so? Das ist nie ein Deppen-Apostroph gewesen?
In diesem Fall nicht. Er dient hier der Abtrennung und der Sicherung des Eigennamens. Und wenn Eva nicht will, dass aus ihrem Namen Evas wird, dann ist das in Ordnung. Nicht richtig wäre, wenn Sie schreiben würden: "Das ist Eva’s Nudelholz, nicht deines." Hier muss es heißen: "Das ist Evas Nudelholz."
Wenn "Evas Nudelholz" aber ein Laden wäre, in dem Eva Nudeln herstellt und verkauft, dann wäre "Eva’s Nudelholz" wieder richtig?
Genau. Das abgetrennte "s" dient auch dazu, die Mehrdeutigkeit bezüglich Eigennamen zu vermeiden. Das möchten viele und haben es auch so angewendet. Nehmen wir "Carlos Taverne". Durch das "s" am Ende kann hier eine Mehrdeutigkeit entstehen, die ich bei einem Eigennamen lieber vermeiden möchte. Heißt der Besitzer Carlo oder Carlos? Bei "Carlo’s Taverne" wird es klar. Wir beobachten, wie Schreiber und Schreiberinnen Schriftsprache verwenden. Dies kann die Grundlage für eine empirische Evidenz sein, die wir als Rat ernst nehmen.
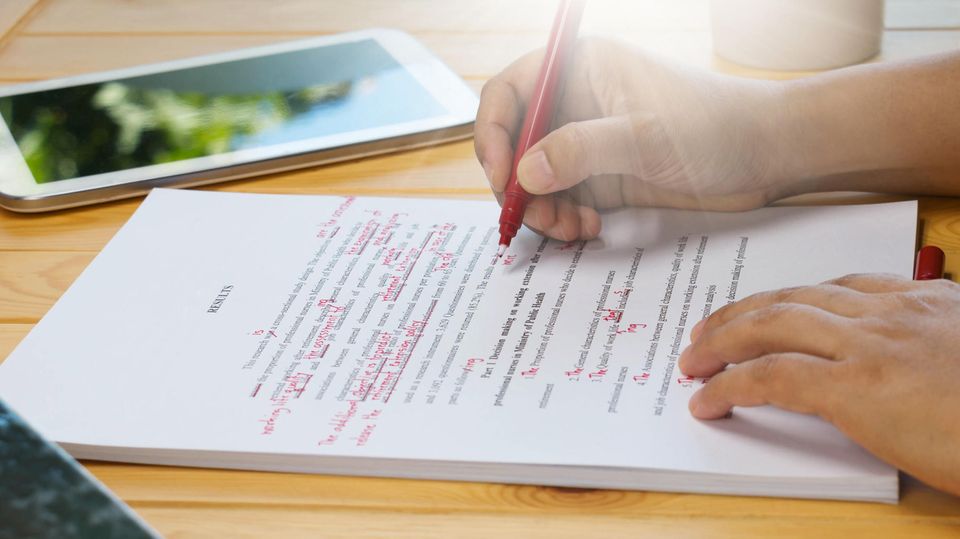
Menschen müssen nur lange genug etwas falsch schreiben, dann passt man die Regeln an? Nur weil plötzlich 70 Prozent der Leute sagen, dass zwei plus zwei fünf ergebe, ist es ja trotzdem nicht richtig.
Schreibung und Mathematik kann man nicht vergleichen. Schreibung ist offener, wandelbarer – und muss das auch sein. Schreiberinnen und Schreiber nehmen Eigennamen ernst und schützen sie mithilfe des abgetrennten Genitiv-s sozusagen. Darauf haben wir als Rat reagiert. Wenn sich ein Friseur Hairlich nennt, dann ist das eine Vermischung von Englisch und Deutsch, aber natürlich darf der Schreibende das. Eigennamen sind eben etwas Besonderes, wie ein Titel oder eine Marke.
Wer sitzt im Rat der Rechtschreibung?
Wir sind 41 Mitglieder aus sieben Ländern und Regionen. Und natürlich nicht nur ausgewiesene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, es sind Vertreter von Zeitungen dabei, von Schulbüchern, Lexika, Pädagogen, Journalisten, Schriftsteller. Wir diskutieren leidenschaftlich und es dauert hin und wieder, bis wir uns einig sind.
Wie viel Regelung braucht die deutsche Schriftsprache?
Wir haben ein amtliches Regelwerk, das für alle deutschsprachigen Länder und Regionen verbindlich ist. Das dient einer gelingenden schriftlichen Kommunikation und es ist natürlich auch ein Kulturgut. Aber es ist schon interessant, wie schnell es emotional wird, wenn es um Schrift und um Sprache geht. Es ist immer einfacher, wenn sich Veränderungen über die Zeit entwickeln. Plötzlicher Wandel fällt uns oft schwer.
Zur Person
Prof. Dr. Angelika Wöllstein ist stellvertretende wissenschaftliche Direktorin des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache, Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung und dort Vorsitzende der Arbeitsgruppe Linguistik. Sie hat in der vergangenen Amtsperiode maßgeblich am Kapitel "Zeichensetzung" für das aktualisierte "Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung" mitgewirkt.
Wie schmal ist der Grat zwischen "Sprache lebt und verändert sich" und "Regeln sind wichtig, um die Sprache zu schützen"?
Wir müssen da unterscheiden. Sprache verändert und entwickelt sich, etwa bei Fremdwörtern, die wir nutzen. Da wird über die Zeit aus dem Friseur der Frisör. Das ist die Integration ins deutsche Schriftsystem, die sich über die Zeit vollzieht.
Auf der anderen Seite gibt es Fälle, in denen die Regeln eher geschärft werden müssen, weil wir feststellen, dass sich bestimmte Fehlerschwerpunkte zeigen. Das deutet meist darauf hin, dass die Regelung nicht klar genug gefasst ist, etwa bei den Kommaregeln. Jede und jeder soll sich die Schreibung durch die Regeln selbst erschließen können, anhand der prototypischen Beispiele. Zur Zeichensetzung kann man nicht einfach im Wörterbuch nachschlagen. Wir blicken also in zwei Richtungen: Nachjustieren und Präzisieren.
Haben Sie ein Beispiel, in dem sich unsere Art zu Schreiben gewandelt hat, das wir heute völlig normal finden?
Natürlich. Nehmen wir "am" – ein Wort, das zusammengezogen wurde aus "an dem". Das findet niemand mehr komisch. Der Ausdruck "Wie geht‘s?" könnte einer sein, bei dem der Apostroph auch irgendwann verschwindet. Weil es zu einem festen Ausdruck wird, zu einer Art Formel. Das ist ein normaler grammatikalischer Prozess, nämlich eine Verschmelzungsform, die sich mit der Zeit entwickelt. So wie bei "am" oder "beim".
Wird das beim Thema gendergerechte Sprache und Schreibweise vielleicht auch irgendwann so sein?
Da würde eine Versachlichung der Diskussion guttun. Es ist schade, wenn hier Spaltungen entstehen, das halte ich für ganz schwierig. Es geht dabei um Gerechtigkeit – und das ist ja ein solides Anliegen.



