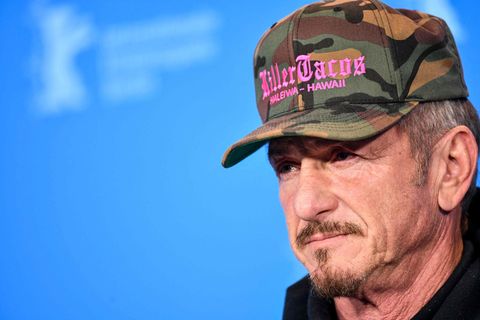Einmal werden wir noch wach, dann ist endlich Bären-Tach. Samstag ab 19.30 Uhr, werden die Entscheidungen von Paul Schrader und Konsorten im Berlinale Palast verkündet. Und es dürfte allein deshalb schon die eine oder andere Überraschung geben, weil es – außer vielleicht Marianne Faithful für Ihre Vorstellung als "Irina Palm" - keine klaren Favoriten hervorstechen. Ein Querschnitt durch die Kritikerspiegel in den Tageszeitungen: Dort liegen mit "Die Fälscher", "Tuyas Ehe", "Der gute Hirte", "Yella" und "Irina Palm" gleich fünf Kandidaten in Goldnähe.
Kein Ärger wegen der Lerchen
Noch nicht berücksichtigt sind dabei die drei Wettbewerbsbeiträge, die heute über die Leinwände flimmerten und allesamt das Niveau für einen Preis hätten. Womit wir auch schon bei den Überraschungen der letzen beiden Tage wären. Da bestätigten sich zunächst einmal nicht Dieter Kosslicks Befürchtungen von Demos, Tumulten oder sonstigen Störfeuern bei der Berlinale-Special-Premiere des Gebrüder-Taviani-Films "Das Haus der Lerchen". Die einzigen Gefechte lieferten sich hier die Kritiker, die das Epos über die türkischen Massaker 1915 an den Armeniern entweder als kitschig oder grandios einstuften.
Auch erstaunlich, dass der 78-jährige Nouvelle-Vague-Veteran Jacques Rivette mit seiner Balzac-Adaption "Ne touchez pas la hache" (Die Herzogin von Laneais) mal unter drei Stunden blieb. Allerdings waren zahlreichen Kollegen selbst die 137 dialogintensiven Minuten zu lang, so dass viele von ihnen vorzeitig ins Freie flüchteten.
Nette Monster aus Moskau
Ebenfalls nicht damit zu rechnen war, dass die russische Fantasy-Kapriole "Wächter des Tages" besser und witziger war (allerdings leider auch eine Viertelstunde zu lang), als ihr Vorgänger "Wächter der Nacht", der bereits vor zwei Jahren bei der Berlinale für Kurzweil gesorgt hatte.
Die schönste Überraschung aber waren die drei eingangs erwähnten Bären-Konkurrenten, von denen der beste gleich morgens um neun für kollektiv gute Laune sorgte. Mit "Ich habe den englischen König bedient" kehrte der tschechische Altmeister Jirí Menzel nach 17 Jahren wieder hinter die Kamera zurück, was er bei der Pressekonferenz charakteristisch trockenhumorig so begründete: "Das Honorar stimmte."
Basierend auf der Roman-Groteske seines Leib-und Magen-Autoren Bohumil Hrabal, erzählt er vom Aufstieg und Fall des pfiffigen kleinen Provinzkellners Jan Dite (famos: Ivan Barney). Der bringt es mit Geschick und Anpassungsfähigkeit zum Chefkellner des besten Prager Hotels, gerät durch die Heirat mit der Sudetendeutschen und strammen Hitler-Anhängerin Lisa (Julia Jentsch) auf die falsche Seite und steigt mit beschlagnahmten jüdischen Millionen in Form von Briefmarken zum Millionär auf. Worüber er sich allerdings nur kurz freuen kann, denn nach Kriegsende enteignen ihn die Kommunisten und stecken ihn für 15 Jahre ins Gefängnis. Eine wunderbare Burleske, überbordend in ihrem Einfallsreichtum, weise, gewitzt, frech, boshaft und stets unterhaltsam - absolut bärenverdäcthig. Es wäre Menzels zweiter nach 1990. Damals wurde er für seinen wiederaufgeführten Regal-Film "Lerchen am Faden" (1969) ausgezeichnet.
Keine Zeit für den Umschnitt
Ein gelungener Wurf ist auch britische Beitrag "Hallam Foe" von John Mackenzie über einen Teenager, der den Tod seiner Mutter nicht verwinden kann und erst durch die Begegnung mit der Edinburgher Hotelangestellen Kate (Mrs. Winslet, Sie bekommen Konkurrenz: Sophia Miles), die der Verstorbenen frappierend ähnlich sieht, seine Dämonen besiegen kann. Mit seiner nuancierten Verkörperung des Titelhelden steht Jamie Bell - bekannt aus "Billy Elliot" und aktuell zu sehen in Clint Eastwoods "Flags Of Our Fathers" - ziemlich weit oben auf der Darsteller-Bären-Liste.
Mittelschwere Schwindelattacken bescherte die Chinesin Li Yu dem Publikum zu guter Letzt noch mit den teils unnnötigen Handkamera-Exzessen in ihrem geschickt konstruierten Peking-Drama "Ping Guo" (Lost in Beijing), das sich mit der Situation der unzähligen in die Hauptstadt strömenden Bauern beschäftigt. Zwei von ihnen sind die hübsche Liu Ping Guo, die in einem Massagesalon angestellt ist und ihr als Fensterputzer arbeitender Mann An Kun. Das kleine Glück der beiden gerät in Schieflage, als dieser zufällig Zeuge wird, wie Ping Guo in volltrunkenem Zustand von ihrem mit ihrem Chef Lin Dong vergewaltigt wird. Als die Frau schwanger wird, machen die beiden Männer einen Deal: Ein Bluttest nach der Geburt soll klären, wer der Vater ist. Entpuppt sich Lin Dong als der Erzeuger, behält er das Kind und zahlt An Kun 100.000 Yuen. Am Ende allerdings wird keiner glücklich sein.
Dafür aber die Regisseurin. Li Yu durfte nach langem Hin und Her die unzensierte Fassung ihres dritten Spielfilms in Berlin präsentieren. Für das Umschneiden - konkret 15 Änderungen, die ihr die chinesischen Behörden wegen einiger freizügiger Sexszenen und der Darstellung von Korruption auferlegt hatten - fehlte schlichtweg die Zeit. Auch für Li stehen die Chancen auf den Goldenen Bären nicht schlecht, allerdings weniger aus künstlerischen, sondern politischen Gründen. Wir erinnern uns: Die letzten beiden Jahre gewannen den Hauptpreis ein südafrikanisches Township-Musical und ein bosnisches Balkankrieg-Drama.
Wie auch immer, morgen sind wir schlauer. Und danach wird erstmal eine Woche geschlafen.