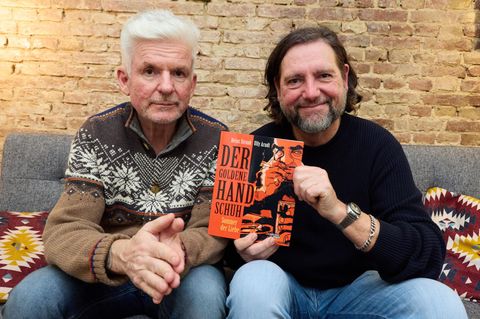Vorbei sind die Zeiten, in denen das französische Kino von männlichen Großmeistern beherrscht wurde. Es sind die Frauen, die in diesen Monaten das französische Kino regieren. Junge Regisseurinnen halten die Fäden in der Hand und verwirklichen Filme, für die das französische Kino schon immer stand: Sie zeigen das Leben, wie es ist. Die Frauen hinter der Kamera erzählen die Geschichte von Mädchen und jungen Frauen, die alle auf ihre ganz eigene Weise mit dem Erwachsenwerden kämpfen.
"Persepolis" mit Chancen auf den Oscar
Der Film von Satrapi beruht auf dem von ihr gezeichneten gleichnamigen Comic. Der erste Band erschien 2000 in Frankreich und wurde zu einem großen Überraschungserfolg. Mittlerweile ist der autobiographische Comic über ihr Leben im Iran in sechs Sprachen übersetzt worden. In deutscher Sprache gliedert sich die Geschichte in zwei Bände: "Persepolis - Eine Kindheit im Iran" und "Persepolis - Jugendjahre". Der Comic wurde schnell vom Geheimtipp zum viel besprochenen Werk - in Comic-Kreisen, und, was noch bedeutsamer ist, auch in der Welt der Literatur. Satrapi ist die erste orientalische Comic-Zeichnerin mit internationalem Erfolg.
Die Iranerin wurde 1969 in Teheran geboren und lebt seit 1994 in Frankreich. Vor ihrem Erfolg als Comiczeichnerin war sie Kinderbuch-Illustratorin. Nun probierte sie sich auch als Regisseurin und verfilmte ihren Comic. Entstanden ist ein ergreifender Film, der mit schwarz-weiß Bildern und viel Humor besticht. Auch bei den anderen Filmen handelt es sich um die Erstlingswerke der französischen Filmemacherinnen. Das französische Kino hat in jedem Fall einen ganz klaren Trend: Frauen erzählen von Frauen. Statt den Kampf "Küche versus Karriere" zu führen, setzen französische Regisseurinnen sich auf differenziertere und subtilere Weise mit dem Frau-Sein auseinander.
"Persepolis"
Ein französischer Animationsfilm in schwarz-weiß, Schauplatz: Iran. "Persepolis" ist die Autobiographie und gleichzeitig das Regiedebüt der französisch-iranischen Künstlerin Marjane Satrapi. Mit ausdrucksstarken, teils surrealistischen Bildern, pointierten Dialogen und einer erzählerischen Leichtigkeit zeigt der Comic-Film die Geschichte eines Mädchens, das in Zeiten von Revolutionswirren, Krieg und Exil erwachsen werden muss. "Persepolis" bringt einen gleichzeitig zum Lachen, Weinen, Nachdenken, Schmunzeln und Verzweifeln. Es gelingt den Regisseuren (Satrapi und Vincent Paronnaud) auf liebevolle Weise und mit viel Humor, gleichzeitig ein persönliches und ein brisantes politisches Drama zu erzählen. Als Vorlage diente der von Satrapi gezeichnete gleichnamige Comic. Die Hauptfigur Marjane erlebt in Teheran die iranische Revolution der 70er Jahre, die Repressionen des neuen Regimes, den ersten Golfkrieg und das Exil in Wien. Wenn das Mädchen als Revolutionsheldin verkleidet durch die Wohnung stapft oder nach der Exekution des Onkels verzweifelt den bärtigen Mann im Himmel anschreit, dann vermittelt dieses Kind eine Echtheit und Intensität, wie es selten eine Figur im Kino geschafft hat
Frankreich, Filme und die Frauen
Es geht bei den Filmen um die Probleme junger Mädchen, die sich selbst finden müssen, die ihren Platz im Leben suchen und an ihrem eigenen Körper und Können zweifeln. Die französischen Regisseurinnen haben das Thema facettenreich und jede mit einem ganz eigenen Zugang umgesetzt. Ihr Erfolgsrezept heißt Gefühle - sie alle transportieren ihre Geschichte durch die Emotionen der Protagonistinnen, sei es Wut, Freude, Gleichmut, Verzweifelung, Trauer, Stolz, Hass oder Liebe.Vielleicht ist aber auch noch ein anderer Grund mitverantwortlich für die vielen erfolgreichen Frauen hinter der Kamera: In Frankreich sind 80% der Frauen berufstätig, ihre Arbeit ist im Kulturbetrieb ist seit langem anerkannt und ihre Position gefestigt.
So haben es nun vielleicht auch die französischen Regisseurinnen leichter, sich in der kleinen Welt von Filmförderung, Filmkritikern und Filmstudios zu behaupten. Und das tun sie mit Erfolg, wie die vielen Filmdebüts zeigen: Marjane Satrapi ("Persepolis"), Lola Doillon ("Et toi, t'es sur qui?"), Zina Modiano ("La Vie privée"), Céline Sciamma ("Naissance des pieuvres"), Anne le Ny ("Ceux qui restent"), Mia Hansen Love ("Tout est pardonné") und Audrey Estrougo ("Regarde-moi"). Die Geschichten, die die jungen Regisseurinnen erzählen, erinnern an den berühmten Satz der französischen Philosophin Simone de Beauvoir: "Man wird nicht als Frau geboren: man wird es" ("On ne naît pas femme: on le devient"). Es scheint den französischen Frauen ein Anliegen zu sein, diesen steinigen Weg vom Erwachsenenwerden auf die Leinwand zu bringen. Sie haben es am eigenen Leibe erfahren und wählen somit ein ganz persönliches Thema, um in der Kinoszene Fuß zu fassen.
Kleine Geschichten - großes Kino
Céline Sciamma sagte bei der Premiere ihres Filmes: "In den Jugendjahren, diesem empfindlichen Moment des Auftauchens der Weiblichkeit, haben die Mädchen vielleicht mehr Dinge zu regeln als die Jungen, und wir, die Filmemacherinnen, somit mehr Gründe, in unseren Filmen davon zu erzählen."
Sciammas Film handelt von drei fünfzehnjährigen Mädchen, die ihren Körper und die Sexualität, vor allem die Homosexualität, entdecken. Ihre 26-jährige Kollegin Mia Hansen-Love erzählt in ihrem Regiedebüt "Tout est pardonné" die Geschichte einer jungen Frau, die ihren Vater wieder findet. Hansen-Love wuchs in Paris auf und stand mit 16 Jahren das erste Mal vor der Kamera. Sie besuchte nach dem Abitur das "Conservatoire d'art dramatique" in Paris und schrieb für die französische Zeitschrift "Les cahiers du cinéma" Filmkritiken. Ihr Regiedebüt war eine der großen Entdeckungen der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes. Hansen-Loves Konzept: "Ich hab keine Lust Filme zu machen um repräsentative Menschen zu zeigen. Ich mache Kino um Menschen zu filmen, die ich mag, und um eine Wahrheit zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, Allgemeinheiten zu vermeiden," sagt sie gegenüber der Zeitschrift Nouvelle Observateur.
Auch Marjane Satrapi, die Macherin von "Persepolis", sagt gegenüber der Zeitung Le Monde: "Meine Sichtweise ist subjektiv. Ich bin nicht das Sprachrohr des Irans oder einer Generation, ich möchte es auch nicht sein. Ich übernehme die Verantwortung für diese Subjektivität, nur sie erlaubt eine Identifikation. Man kann sich nicht mit einem Land identifizieren, aber man kann sich mit einer Person identifizieren." Deshalb sind die Frauen im französischen Kino gerade so erfolgreich - weil sie kleine Geschichten erzählen, die zu großem Kino werden. Weil sie nicht belehren oder aufklären wollen, sondern uns sehen lassen.