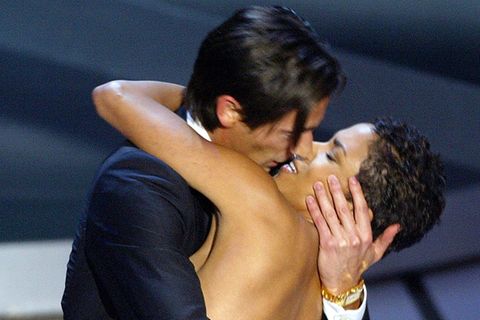Herr Wenders, Sie waren diesmal nicht alleiniger Regisseur Ihres für den Dokumentar-Oscar nominierten Films, sondern verantworten das Werk gemeinsam mit Juliano Ribeiro Salgado. Wie hat das funktioniert?
Es war nicht einfach herauszufinden, wie wir beide aus so unterschiedlichen Perspektiven - ich aus der Sicht eines Freundes und Juliano aus der Sicht des Sohnes - einen gemeinsamen Film hinkriegen. Das war ein richtiges Problem. Wir haben natürlich erstmal getrennt angefangen zu schneiden, jeder sein eigenes Material. Und dann haben wir versucht, das zu kombinieren. Und was immer wir auch gemacht haben - es sah nicht nach einem Film aus.
Wollten Sie das Projekt aufgegeben?
Ich hätte auch gut und gern den Film allein machen können. Mit meinem Material. Und Juliano ganz bestimmt auch. Das wären dann zwei sehr verschiedene Filme geworden. Aber wir wussten auch, wenn wir das zusammen hinkriegen, machen wir ganz bestimmt einen besseren Film.
Wie haben Sie den Knoten zerschlagen?
Schließlich kam die entscheidende Erkenntnis: Dass wir es nicht mehr getrennt schneiden können, und auch nicht mit einem Cutter gemeinsam - wir mussten uns gegenseitig an unser eigenes Material heran lassen.
Das geht ans Eingemachte.
Es war ein schmerzhafter Prozess für uns beide. Aber wir haben gemerkt, dass es nicht anders geht. Es hat lange gedauert, bis die Egos nicht mehr so empfindlich waren.
Der Film hat nun drei Erzähler. Wie kam es dazu?
Weil Sebastiao so viel erzählt, haben wir auch lange versucht, ohne Erzählstimme auszukommen. Dieser gemeinsame Film konnte aber nur entstehen, wenn Juliano und ich auch als Autoren vorkommen.
Sie haben viel Autonomie abgegeben. Ist "Das Salz der Erde" die Produktion, bei der sie am wenigsten Hoheit über das Ergebnis hatten?
Kann ich so nicht sagen, denn das, was am Ende heraus kommt, ist schon sehr von meinem Formwillen getragen. Gerade auch die entscheidenden Elemente, was Sebastiao betrifft, also seine Geschichten, und wie er als Erzähler im Film auftritt.
Es ist ja schon ein Paradox: Sie haben einen Film über die stehenden Bilder eines Fotografen gemacht. Wie kam es dazu?
Meine Bereitschaft, den Film mit Sebastiao Salgado zu machen, kam aus meiner Begeisterung für seine Bilder, und für die Arbeitsweise, die Ethik, aber auch die Schönheit, die dahinter steckt. Und für die Wahrheit in seinem Werk. Aber es war auch die große Frage: Wie kriegt man aus diesen "still images" tatsächlich "moving pictures"?
Sie treten mit ihrem Gestaltungswillen in den Hintergrund, zugunsten der Bilder Salgados.
Wir haben alles auf sein Gesicht, die Bilder und seine Geschichten dazu reduziert, und plötzlich bekamen die Fotos einen Rhythmus. Durch seine bewegenden Geschichten wurden sie zu bewegten Bildern. Und ich glaube schon, dass man es nach einer Weile vergisst, das es nur - in Anführungsstrichen - Fotos sind.
Salgados vorerst letztes großes Werk, "Genesis", würdigt die Schöpfung. Sie sind bekennender Christ - welche Rolle spielt das Gottesfürchtige, das in Salgados Bildern steckt, für Sie?
Ich glaube, das ist leicht zurückzuführen auf den Begriff von Respekt. Den Respekt, den er als bekennender Marxist vor dem Individuum und vor der Würde des Menschen hat, der unterscheidet sich de facto nicht vor dem Respekt, den ich als Christ vor jedem anderen habe. Und vielleicht steckt in dieser lateinamerikanischen Befreiungstheologie auch der Ansatz für uns beide, diese Kombination aus Marxismus und Christentum. Das war auch für mich ein großes Ding damals, das waren meine großen Helden. Aber zu der Zeit war es noch undenkbar, dass ein Junge aus dem Ruhrgebiet nach Südamerika fährt.
Sie waren Sonntagabend zum dritten Mal für einen Dokumentarfilm nominiert. Der erste handelte von Musik, der zweite vom Tanz, der dritte von der Fotografie. War das geplant?
Die haben sich alle von selbst ergeben, es gibt keinen Masterplan.
Gegen "Buena Vista Social Club" siegte ein Film mit politischem Inhalt, es ging um das Attentat bei den Olympischen Spielen 1972. Und dieses Jahr hat die Dokumentation über Edward Snowden gewonnen. Kommt Kultur nicht gegen Politik an?
Das ist in der ganzen Geschichte der Osars immer der Fall gewesen. Außerdem hat noch nie eine Komödie gewonnen. Doch - einmal: Roberto Benignis Film "Das Leben ist schön". Das war eine krasse Ausnahme. Im Dokumentarfeld sind politische, soziale Themen immer weit vorn gewesen.
Kränkt Sie das?
Kann ich nicht sagen. Ich finde es eigentlich erstaunlich, dass meine Filme sich dreimal bis da vorn 'reingeschoben haben. Sie sind doch sehr weit von dem entfernt, was in den USA als wichtig empfunden wird.
Aber Kuba ist doch auch ein amerikanisches Thema.
Als ich mit "Buena Vista Social Club" 2000 nominiert war, fragte mich damals mein Nachbar in Los Angeles, wo Kuba denn eigentlich liege. Und er wollte es kaum glauben, dass man bei klarem Wetter von Havanna aus Miami sehen kann. Die Amerikaner hatten vergessen, dass es dieses Land überhaupt gab.
Statt "Pina" hat 2010 ein Film über ein Football-Team gewonnen.
Meiner festen Überzeugung nach ist das eigentlich gar kein Dokumentarfilm. Er ist komplett inszeniert. Aber das habe ich damals nicht gesagt. Das hätte wie Nachtreten geklungen. Aber es war dasselbe Phänomen: Filme mit einem kulturellen Mehrwert schneiden schlechter ab. Das ist ja auch kein Wunder, in Amerika gibt es noch nicht mal einen Kulturminister. Bei uns in Europa sind Filme eben in erster Linie Kulturgut, und hier in den USA sind sie Wirtschaftsgut.
Machen die ganzen Online-Umfragen eigentlich die Spannung kaputt?
Die Vorhersagen haben jedes Mal daneben gelegen. Auch diesmal.