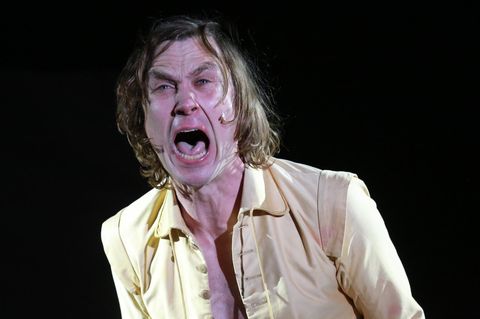Vor einer weiß gekalkten Wand posiert eine Frau. Sie hat den dürren Körper eines Kindes und den Kopf einer Erwachsenen. Ihre Beine stecken in transparenten halterlosen Strümpfen. Die langen blonden Haare verdecken ihr Gesicht und reichen bis zu einem weißen breiten Gürtel, der ihre ohnehin schon verboten dünne Taille noch weiter betont.
Dieses Bild stammt nicht etwa aus einer neuen Haute Couture-Werbekampagne, sondern aus der Ausstellung "Zweiunddreißig Kilo", die am Freitagabend im C/O Berlin Eröffnung feierte.
Ein Artikel über eine Internetbewegung namens "Pro Ana" habe ihr die Idee für die Fotoserie geliefert, erklärt die Fotografin Ivonne Thein. Ana steht für Anorexia nervosa, die klinische Bezeichnung für Magersucht. Die Mitglieder der Pro-Ana-Foren sind junge Frauen, die sich gegenseitig darin bestärken, Magersucht sei keine Krankheit, sondern ein Lifestyle. Als Motivation werden Bilder der dünnsten XXS-Models und Schauspielerinnen hochgeladen. "Das war sehr schockierend", sagt Thein. "Allerdings ist es für mich als Fotografin auch faszinierend, dass sich Menschen so stark an Bildern orientieren."
Modedesigner geben Richtung vor
Tatsächlich vermitteln Medien tagtäglich ein sehr schlankes Schönheitsideal. "Sogar die Kleiderindustrie geht mit diesem Trend", so Thein. Wer vor ein paar Jahren noch in Konfektionsgröße 36 oder 38 gepasst habe, müsse heute in vielen Läden zu Größe 40 greifen. "Am überspitzten Schlankheits- und Schönheitsbild zu rütteln, wird schwierig bleiben, solange die Modedesigner sich nicht von diesem extrem dünnen Ideal distanzieren." Im vergangenen Jahr war eine Diskussion um ein verpflichtendes Mindestgewicht für Models entbrannt, nachdem ein 18jähriges Model aus Uruguay an den Folgen von Magersucht gestorben war. Die meisten Modedesigner weigerten sich jedoch, ultradünne Models von den Laufstegen zu verbannen. Eine Mindestgröße sei irreführend, weil auch sehr zarte Mädchen völlig gesund sein könnten. Die Verantwortung für ihre Körper liege bei den Models selbst, sagte damals auch Topmodel Naomi Campbell. "Die Wahrheit ist, dass Modeschöpfer sich durch die Forderung von Mindestmaßen in ihrer Künstlerfreiheit beschnitten fühlen", meint Thein.
Ein zweites Bild. Das Model trägt hochhackige weiße Römersandalen. Zerbrechliche Arme und Beine stemmen den dürren Oberkörper in die Luft. Die junge Haut verhüllt keine Muskeln und kein Fettpolster, sondern nur die blanken Knochen. Auch hier ist das Gesicht verdeckt, um den Kopf sind dicke Mullbinden gewickelt.
Niemand wollte mitmachen
"Durch die verdeckten Gesichter schaffe ich eine Anonymität", erklärt Ivonne Thein. Ohne Gesicht sei der emotionale Bezug weg. "Der Betrachter soll sich nicht mit den abgebildeten Mädchen identifizieren können." Zusätzlich symbolisieren die Bandagen physische und psychische Erkrankung.
Im wahren Leben ist keine der abgelichteten Frauen krank. Sie stammen aus dem Freundeskreis der 28-jährigen Fotografin und sind "normal gebaut", wie Thein betont. Damit sie zu den Hungerhaken wurden, die man nun in der Ausstellung sehen kann, hat Thein viel Zeit am Computer verbracht. "Als ich ihnen die fertigen Bilder zeigte, waren sie alle total schockiert, keine hat sich wieder erkannt."
Ursprünglich habe sie schon magersüchtige Mädchen für die Fotoserie ablichten wollen, so wie Oliviero Toscani in seiner Kampagne gegen Magersucht. Nur fanden sich keine essgestörten Mädchen, die bereit waren, sich an einer solchen Fotoserie zu beteiligen. So entstand die Idee, Bilder normalgewichtiger Frauen am Computer zu verändern. In der Modefotografie ist dies gängige Praxis. Jedes Modefoto wird nachbearbeitet, bevor es auf dem Cover eines Hochglanzmagazins landet. "Vielleicht wird Betroffenen dadurch ja klar, dass die Bilder, denen sie nacheifern, nicht der Wirklichkeit entsprechen", sagt Thein. "Denn Fotografie ist kein wahrheitsgetreues Medium."
Infobox: Bis zum 11. Mai kann man die insgesamt 14 Bilder der Ausstellung "Zweiundreißig Kilo" im C/O Berlin in der Oranienburger Straße bewundern. Ab September sind die Bilder dann im Goethe Institut in New York zu sehen.