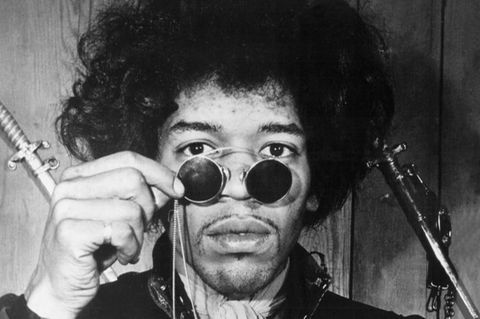Sobald die Festivalsaison begonnen hat, zieht es jedes Jahr zehntausende Musikfans auf Wiesen, Felder und Plätze in ganz Deutschland, um unter freiem Himmel zu lauter Musik zu feiern. Sie hinterlassen tonnenweise Müll, zertrampelte Natur und überdüngten Boden, verursachen jede Menge Abgase und Lärmbelästigung für Mensch und Tier. Das Festival "Rock im Park" verbraucht mehr als 120.000 Kilowattstunden Strom - das reicht nach eigenen Angaben "für die Versorgung einer Kleinstadt". Kein Wunder: Drei Bühnen brauchen an drei Tagen jeweils circa elf Stunden Strom.
Rock 'n' Roll im Wasserschutzgebiet
Dass es auch anders geht, beweist die Initiative "Sounds for Nature". Das Bundesamt für Naturschutz, die Musikagentur "Koks", die Deutsche Rockmusik Stiftung und das Institut für Umweltkommunikation haben ein Programm entwickelt, Musikfestivals umweltfreundlicher zu gestalten. Sie veröffentlichen einen Leitfaden für Veranstalter und verleihen seit 2002 ein Siegel, das den Festivals ihre Naturfreundlichkeit bescheinigt.
Das Rheinkulturfestival an der Bonner Rheinaue ist das größte Open Air Festival mit diesem "Sounds for Nature"-Siegel. Es hat diese Auszeichnung 2007 zum dritten Mal bekommen. 2006 lockte das kostenlose Festival 100.000 Musikbegeisterte an, in diesem Jahr waren es sogar 200.000. "Wir haben mit Sounds for Nature aus der Not eine Tugend gemacht", sagt Sabine Funk, Geschäftsführerin der Rheinkultur GmbH. Das Festivalgelände liegt in einem Natur- und Erholungspark: Die Rheinaue ist Wasserschutzgebiet. Deshalb musste das Festival schon immer hohen Umweltansprüchen gerecht werden. Seit 2004 nimmt es am "Sounds for Nature" Programm teil.
Weitere Informationen:
Zu "Sounds for Nature": www.bfn.de/sounds
Zur "European Festival Association": www.yourope.org
Zum Rheinkulturfestival: www.rheinkultur.com
"Ecotainment" und Bio-Bratwurst
"Wir dachten erst, wir haben eh' keine Chance, weil wir ein so großes Festival sind", erzählt Sabine Funk. Doch "Sounds for Nature" stellt keine festgelegten Forderungen an die Festivalbetreiber. Stattdessen wird die Bewertung individuell an die Veranstaltung angepasst. Die Initiative berät die Veranstalter und vereinbart mit ihnen Maßnahmen zur Verbesserung. Nach dem Festival wird Bilanz gezogen. Wer sich einmal mit dem Siegel schmücken durfte, kann sich nicht auf seinen Umwelt-Lorbeeren ausruhen: Die ganze Prozedur steht in der folgenden Saison wieder an.
"Ecotainment", so heißt das Konzept, das auf die schrittweise Verbesserung der Festivals setzt. Auf einige Kriterien wird dabei besonderer Wert gelegt: Verkehrsaufkommen, Abwasser, Toiletten, Abfall, Verpflegung, Camping und Belastung durch Lärm. Das bedeutet konkret: Die Festivalbesucher sollen mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen, möglichst wenig Müll zu produzieren und ihre Notdurft nicht in freier Natur zu verrichten. Umweltschädliche Chemietoiletten weichen Sanitäranlagen mit Anschluss an die Kanalisation. Die Essensstände werden angehalten, ihr Geschirr vor Ort spülen und so Einweggeschirr zu ersetzen. Außerdem sollen Lebensmittel aus der jeweiligen Region und Öko-Produkte bevorzugt werden: Bio-Bratwurst statt Döner.
Nicht hinter Ausreden verstecken
Die Maßnahmen sehen nach einem erheblichen Mehraufwand für die Festivalbetreiber aus. Dafür verspricht "Sounds for Nature" einen erheblichen Imagegewinn. Sponsoren und Künstler bringen ihren Namen gerne mit naturfreundlichen Festivals in Verbindung.
Schon beim Rheinkulturfestival 1989 führten die Veranstalter Pfandbecher ein, 1993 stellten sie als erstes deutsches Großevent auf Mehrweg-Polycarbonatbecher um. 2006 testete Rheinkultur Getränkebecher aus Maisstärke - komplett abbaubar. Auch das ist gemeint mit "Alternativen suchen". Ideenreichtum bringt den Vorteil für die Umwelt: Weil die Besucher ungern den dreckigen Deckel einer Mülltonne heben, gibt es "Müll-Silos" - umzäunte Rasenflächen. Auch die Idee, Pfadfindergruppen mit dem Aufsammeln von Pfandflaschen zu beauftragen, hat sich bewährt. Stadt und Veranstalter sparen Reinigungskosten und der Pfand geht an einen guten Zweck.
Nicht nur für Sandalen tragende Freaks
"Sounds for Nature" ist nicht das einzige Projekt, das sich für den Umweltschutz bei Musikfestivals einsetzt. "Yourope", die "European Festival Association", hat 2007 erstmals nach einem festgelegten Kriterienkatalog den "Green 'n' Clean Award" verliehen. Rheinkultur wurde auch mit diesem Preis ausgezeichnet. Anhand eines Fragebogens werden Punkte vergeben, bisher können sich aber nur Mitglieder von "Yourope" bewerben. 26 Festivals haben es insgesamt versucht, nur sechs sind wirklich "grün und sauber".
"Bitte lasst euer Auto zu Hause!", heißt es auf der Homepage des Rheinkulturfestivals klar und deutlich an die Adresse der Besucher. Es wird eine vergünstigte Fahrkarte für den gesamten Verkehrsverbund angeboten - mit einem Mausklick kann man sie online kaufen. Die Homepage ist außerdem direkt mit Mitfahrzentralen verlinkt.
"Sounds for Nature" will bewusst nicht mit erhobenem Zeigefinger für Naturschutz werben: Moralische Appelle oder wissenschaftliche Argumente schrecken ab. Es sei wichtig, den jungen Leuten klar zu machen, dass Umweltschutz auch cool sein könne, sagt Sabine Funk: "Das ist nicht nur für Sandalen tragende Freaks mit Sonnenblumen im Haar".
Taschen aus Konzertplakaten
Bei "Live Earth" wurde erstmals die Musik ganz in den Dienst des Umweltschutzes gestellt. "Wir werden oft darauf angesprochen. Viele glauben, wir sind mit Rheinkultur jetzt erst auf den Zug aufgesprungen. Dabei setzen wir uns schon seit Jahren mit dem Thema Umweltschutz auseinander", sagt Sabine Funk.
Das vergleichsweise kleine Rheinkulturfestival mutet jedoch auf den ersten Blick umweltbewusster an, als die globale Großveranstaltung. Auf der Homepage des "Live Earth" Spektakels in Hamburg vermisst man den Hinweis auf Mitfahrzentralen, Anfahrtmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind nicht angegeben. Auch ein Hinweis darauf, ob Getränke und Verpflegung mitgenommen werden dürfen, fehlt - bei Rheinkultur dient dieser der Vermeidung der Müllberge am Festivaleingang.
"Live Earth" kann noch lernen
Frank Ehrich, Pressesprecher von Live Earth Hamburg, lässt diese Kritik nicht auf sich sitzen: "Wir haben sehr viel für den Umweltschutz getan. Die Konzerttickets waren gleichzeitig Fahrkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel, der Hambuger Verkehrsverbund hat Wasserstoffbusse für uns eingesetzt." Auf Plakate habe man größtenteils verzichtet: Aus den wenigen PVC-Plakaten wurden Taschen genäht, die auf dem Konzert verkauft wurden.
An den Pfandbechern scheiden sich dagegen die Geister. "Spülen und Desinfizieren von Pfandbechern ist umweltschädlicher als Einweggeschirr. Das wird geschreddert und wieder zu Plastikbechern und Tellern verarbeitet", erklärt Frank Ehrich. Auch bei "Live Earth" wurden die Essensstände verpflichtet, regionale Lebensmittel zu verwenden. Und der Verbrauch an Diesel kann sich sehen lassen: "Wir haben mit zwei Generatoren in neun Stunden 1500 Liter Biodiesel verbraucht." Ein zweistündiges Konzert von Genesis verschlucke dagegen 3000 Liter. Den niedrigen Verbrauch verdanken die Verantstalter sparsamen Bildschirmwänden und Scheinwerfern.
Warum "Live Earth" dennoch so in der Kritik stand, kann sich Frank Ehrich nicht ganz erklären. Greenpeace stieg wegen der Wahl des "Klimaverbrechers" Daimler Chrysler als Sponsor aus den Konzertvorbereitungen aus. Die Rockband "Arctic Monkeys" erklärte, sie halte es für heuchlerisch, die Welt ändern zu wollen und zugleich mit der Bühnenbeleuchtung so viel Strom zu verbrauchen, "wie für zehn Haushalte". "Spiegel Online" rechnete vor, dass der Konzertmarathon bis zu 110.000 Tonnen Co2 verursache. Dass so viel hinterfragt werde, freue Ehrich aber. "Vielleicht haben wir tatsächlich ein bisschen zu wenig publik gemacht, was wir beim Konzert für den Umweltschutz getan haben." Denn was die Informationen für die Besucher angeht, kann "Live Earth" tatsächlich noch etwas von den anderen "Öko Festivals" lernen.