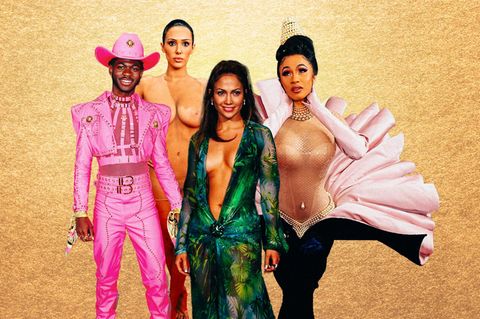Ein Overall von H&M, der den Kampfanzügen kurdischer Kämpferinnen ähnelt, hat bei Facebook und Twitter viele Diskussionen ausgelöst. Dem Modekonzern zufolge war jede Ähnlichkeit unbeabsichtig. Aber der Tarnfleck taucht immer wieder in Schaufenster und auf Laufstegen auf. Warum finden Designer immer wieder inspiration im Krieg? Cathrin Wißmann hat im stern-Extra Mode, Heft 12/2014, darüber geschrieben.
Während uns täglich Meldungen über die Gräuel in Syrien bewegen, macht sich auf unseren Straßen ein Look breit, der eine Hommage an den Krieg zu sein scheint: Camouflage, das Dessin des Kampfes, ist zurück. Befeuert wird der Trend durch die Designer, sie haben den Tarnfleck zum begehrten Muster erkoren. Als stürmten Milizen über den Laufsteg, sah man bei Givenchy Tarnjacken, bei Carven bunte Camouflage-Kleider, bei Stella McCartney Taschen im Fleckenlook. Das Wechselspiel aus Tarnen und Auffallen fasziniert Politik und Mode gleichermaßen.
Während des Ersten Weltkriegs entwickelten die Camoufleurs, eine Gruppe Kubisten und Surrealisten, erstmals den Tarnfleck, der Soldaten der französischen Armee unsichtbar machen sollte. Ihre Idee: die Natur in geometrische Formen zu zerlegen und sie so unkenntlich zu machen. In den Sechzigern war Camouflage das Zeichen der Vietnamgegner, die das Kriegssymbol mit Friedenstauben und „No war“-Aufnähern schmückten und aus seinem militärischen Kontext rissen. Später nutzten die Punks das Muster als Protest gegen die Spießergesellschaft. 1986 war es Andy Warhol, der die Tarnkleidung entmilitarisierte, indem er Selbstbildnisse im bunten Fleckenlook malte. Die Camouflage war Popkultur geworden.
Es ist Krieg, und wir spielen mit
Seitdem wird das Muster kommerziell ausgeschlachtet: auf Tassen, Autos, Hundepullovern, Klopapier, Handtaschen, Lidschatten – und nun in der Kindermode. Ausgerechnet die italienische Marke Benetton, die in den Neunzigern durch sozialkritische Werbung für Aufsehen sorgte, promotete jüngst Kinder in Camouflage-Mode. Von Kritik keine Spur. Ihre Botschaft lautete stattdessen: Es ist Krieg, und wir spielen mit.
Dass man in Zeiten politischer Unruhen ausgerechnet zum Kampflook greift, sagt vieles über unsere Gesellschaft aus: Es ist, als wäre die Messlatte unserer Moral auf Bodennähe gerutscht. 2003, zu Beginn des Irak-Kriegs, sah das noch anders aus. Damals verbot der Musiksender Viva seinen Moderatoren, Camouflage zu tragen. Auch bei H & M erinnerte man sich an seine Vorbildfunktion und verzichtete auf das Muster. Heute, etwa 10 Jahre später, hängt in den Geschäften, was Umsatz bringt. Und dort sieht es mitunter aus wie in den Kleiderkammern von Kasernen. Es ist skandalös, dass einige Modeproduzenten die Augen vor den aktuellen Kriegsgeschehen verschließen und behaupten, Camouflage habe keine militärische Bedeutung mehr. Denn wenn der Tarnfleck nicht mehr ist als eine schicke Hülle, dann hat die Mode den Kampf gegen das Klischee verloren, nur oberflächlich zu sein.