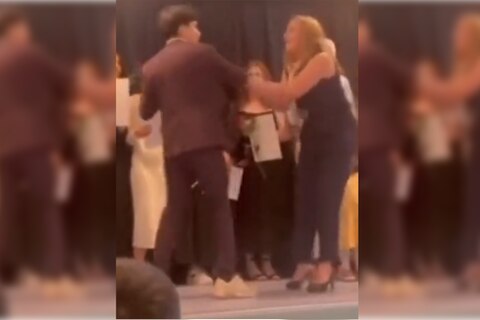Eigentlich sollte es in einer freien Gesellschaft vollkommen gleichgültig sein, was ein Mensch trägt, wie er sich fortbewegt oder jemanden begrüßt. Eigentlich. Aber wie so oft ist die Wirklichkeit eine andere. Und so diskutieren wir dieser Tage über die Frage, was zu tun und zu denken ist, wenn man einem Menschen zum Gruß die Hand reicht – und der darauf erklärt: "Ich kann das leider aus religiösen Gründen nicht machen." Die Hand geben nämlich. Wie oft hat eine solche Konfrontation schon für Unfrieden gesorgt, für Unverständnis, für Empörung und Verletzungen auf beiden Seiten? Der Schüler bei der Abiturfeier, die Frau beim Arzt, der Gast beim Firmenfest – manche dieser Situationen machen Schlagzeilen, andere lösen sich in spontanen, oft humorvollen und von Herzenswärme getragenen Umwegzeremonien auf, je nachdem, welche Interessen und Charaktere gerade aufeinander treffen.
Es gibt im arabischen Raum einen sehr schönen Gruß, bei dem man die Hand aufs Herz legt. Es ist ein in seiner Schlichtheit sehr erhabenes Ritual, das den Grüßenden wie den Begrüßten emporhebt auf eine beinahe schon förmliche, jedenfalls von Respekt getragene Ebene, und ich bemerke immer wieder, dass dieser Gruß mir besonders gut tut. Sie sehen also, ich habe im Grunde nichts gegen verschiedene Begrüßungsrituale. Zudem darf ich, wenn ich das gelernte Prinzip von der Selbstbestimmung ernst nehme, die Verweigerung des Handschlags aus religiösen Gründen nicht krumm nehmen. Doch leider, und Sie ahnen es bereits, folgt ein "Aber", für das ich etwas ausholen muss.
Die Zwietracht
Sylvia Margret Steinitz: Emanzitiert
Sylvia Margret Steinitz war mehr als 20 Jahre lang Journalistin in führenden Positionen, u.a. Chefredakteurin des österreichischen Frauenmagazins Wienerin und zuletzt Kulturchefin des stern in Hamburg. Jemand nannte sie mal "linkslinke Emanze", kurz darauf wurde sie als "rechtskonservative Schreckschraube" tituliert. Man ist sich also nicht einig über sie – und das ist gut so. Der beste Platz einer Journalistin ist schließlich zwischen den Stühlen.
Die Handschlagdebatte ist die jüngste in einer Reihe von kulturellen Konflikten. Die sogenannte Kopftuchdebatte wird ähnlich erbittert geführt. Nur erhält der Handschlag durch seinen zwischenmenschlichen Charakter eine weitere Dimension, die noch mehr dazu geeignet ist, die Emotionen aufzuschaukeln. In meinen Augen hat die Handschlagdebatte das größere Potenzial, unsere Gesellschaft, die sich ohnehin bereits schwertut mit dem multikulturellen Miteinander, noch weiter zu zersplittern und das besonders an Schulen: Zwischen jugendlichem Anecken und dem Aufhetzen der eigenen Kinder gegen den Lehrkörper sind viele Spielarten dieses Kulturkonflikts möglich, und wir werden sie noch alle erleben.
Die Hand als politisches Instrument
Im schwelenden Konflikt aufeinander prallender Volksgruppen und Schichten im globalisierten, sozialstaatlichen Europa erkennen die wirkenden Kräfte in der Handschlagdebatte außerdem eine willkommene politische Waffe: Auf der einen Seite rufen Nationalisten zur "kulturellen Selbstverteidigung" auf. Auf der anderen Seite stehen die politisierten und politisierenden Kräfte, die diverse "Kopftuchverfahren" initiiert und finanziert haben, in denen Frauen ihr Recht auf Tragen einer Kopfbedeckung im Dienst erstreiten wollen, und die nun bestimmt die Gerichte mit "Handschlagprozessen" überziehen werden. Und damit nähern wir uns meinem angekündigten "Aber". Genauer gesagt sind es drei "Aber":
Eine Frage der Höflichkeit
Ich erinnere mich an einen von Kameras festgehaltenen Moment, in dem ein Mann die österreichische Popsängerin Conchita Wurst in ein Gespräch verwickelte und zum Abschied erklärte: "Meine Hand geb' ich Ihnen aber nicht, so bin ich nicht erzogen worden." Die derart Beleidigte, weiblich, barttragende Kunstfigur eines jungen Mannes mit Echtnamen Tom Neuwirth, reagierte mit Würde: "Wenn Sie dazu erzogen wurden, unhöflich zu sein …" Ich weiß nicht, wie ich auf diesen offensichtlichen Versuch der Degradierung reagiert hätte. Aber ich hätte mich in jedem Fall sehr gekränkt gefühlt.
Es würde helfen, wenn man, statt ausschließlich deutschstämmigen Christen oder Agnostikern zu erklären, warum manche Muslime Vertretern des anderen Geschlechts nicht die Hand geben, umgekehrt auch Muslimen erklärte, was in unserem Kulturkreis die Verweigerung des Handschlags bedeutet – nämlich, dass man den anderen für nicht würdig hält, für schmutzig gar, ihn als Person ablehnt. Es würde helfen, zu verstehen, warum ein verweigerter Handschlag auf deutscher Seite so schnell auf die emotionale Ebene wechselt.
Die Sexualisierung der Anderen
Ich stand einmal vor einem jüdisch-orthodoxen Rabbiner, der sich angeregt mit mir unterhielt, mir jedoch zum Abschied nicht die Hand geben wollte. Stattdessen blickte er gelangweilt zur Seite – als hätte ich etwas besonders Dummes gemacht, als ich ihm in Unkenntnis jüdisch-orthodoxer Etikette die Hand zum Abschied hinhielt. Es half nichts, dass die Ehefrau des Rabbiners mir stattdessen liebreich die Hand schüttelte. Ich fühlte mich trotzdem brüskiert – dieser Mann verweigerte mir eine ganz normale Geste auschließlich aufgrund eines religiös legitimierten Regelwerks, das mich als Frau erst sexualisierte und dann aus eben dieser einseitigen Sexualisierung heraus auf Abstand brachte.
(An dieser Stelle muss ich eine Klammer aufmachen: Falls Sie sich gerade fragen, warum mich die Episode mit dem Rabbiner nicht zu einer eigenen Kolumne animiert hat – das liegt daran, dass die Zahl der Jüdisch-Orthodoxen vergleichsweise gering ist und keine nennenswerte Auswirkung auf mein Leben hat. Dass neben Muslimen auch Anhänger anderer Glaubensrichtungen den Handschlag zwischen den Geschlechtern ablehnen, mag dann zum Problem erhoben werden, wenn deren Bevölkerungszahl auf relevante Größe anschwillt. Klammer zu.)
Man darf die Wirkung des verweigerten Handschlags auf eine Frau nicht unterschätzen und schon gar nicht verharmlosen. Es hilft mir nichts, wenn mir jemand erklärt, ich solle mich mal nicht so haben. Das Gleiche könnte man den Männern sagen, die stirnrunzelnd auf meine ausgestreckte Hand starren. Die Verweigerung bedeutet, dass es hier nicht um zwei Menschen geht, die sich in einer freien Gesellschaft begegnen, sondern Menschen werden anhand ihres Geschlechts definiert und kategorisiert. Und: Für Frauen hat dies reelle Folgen, und zwar negative.
Der feministische Aspekt
Die Reglementierung des Kontakts von Männern und Frauen auf Basis eines Glaubens ist nichts Neues und schon gar nicht auf die abrahamitischen Religionen beschränkt. Und mir ist klar, dass es auch Frauen gibt, die Männern nicht die Hand geben wollen. Ein Blick in die Geschichte macht jedoch deutlich, dass dies keine echte Bedrohung für Männer darstellt. Die Sache verläuft stets so: Männer erheben Anspruch auf die religiöse Führung ihrer Gemeinschaft und präsentieren irgendwelche göttlichen Regeln zum Umgang mit dem jeweils anderen Geschlecht. Meist heißt es, das alles geschehe nur aus Respekt vor der Frau, vielmehr noch: zu ihrem Schutz! Die Schutzbezeugung wird in Folge jedoch stets zum Befehl, der Befehl zum Gesetz, das Gesetz zur Grundlage, auf der jede Zuwiderhandlung bestraft wird, die Strafe zum Druckmittel für Männer, ihre Ehefrauen, Schwestern und Töchter noch schärfer zu überwachen. Der Kreis schließt sich nicht, sondern wird zur Spirale, die sich, abwärts drehend, immer enger windet, und – auch das wissen wir aus der Geschichte – in familiären Katastrophen und mitunter sogar gesellschaftlichem Trauma gipfelt.
Eine religiös motivierte Trennung der Geschlechter endet immer darin, dass nicht die Männer, sondern die Frauen verdrängt werden: auf den Balkon, hinter den Vorhang, aus Bereichen, in denen man sich präsentiert, in denen bestimmt und beschlossen wird. Bereits heute habe ich deutsche Mitbürgerinnen, die sich ohne Erlaubnis ihres Mannes nicht frei bewegen dürfen, die ihre sechzehnjährigen Töchter zum Heiraten in ein ihnen fremdes Land schicken, die Angst vor ihrern eigenen Brüdern haben müssen, weil sie anders leben wollen als die Familie es verlangt. Wir deutschen Frauen sind längst nicht alle gleichberechtigt, haben noch lange nicht die gleichen Möglichkeiten. Trends, die mit „Respekt“ beginnen, machen mich unruhig. Weil ich weiß, wie das endet. Kein Wunder, dass bei mir in der Handschlagdebatte trotz aller Liebe zu „Hand aufs Herz“ die Alarmglocken schrillen.
Stellen Sie sich vor, ein Staatsoberhaupt weigert sich, der Bundeskanzlerin im Rahmen wichtiger Verhandlungen die Hand zu reichen, und die versammelte Fotografenschar hält drauf. Niemand kann mir einreden, dass der Symbolwert einer solchen Verweigerung sich nicht negativ auf das Standing der Kanzlerin in den anstehenden Verhandlungen auswirken würde. Ich erinnere zum Vergleich an eine Szene aus dem Buch "Das Euro-Paradox" des ehemaligen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis. Er beschreibt darin, wie der deutsche Finanzminister Schäuble seine zur Begrüßung ausgestreckte Hand ignorierte und ihn mit einem schnöden Wink zu Verhandlungen über das Überleben des griechischen Staats einlud. Schäuble machte damit die Seiten klar. Und die Machtverhältnisse.
Und jetzt?
Das Nicht-Handgeben hat das Potenzial, den bereits existierenden Graben zwischen Muslimen und Nichtmuslimen noch weiter zu vertiefen und birgt das reelle Risiko für politische Zwecke missbraucht zu werden. Keine Frage: Auf uns kommen unschöne Szenen und erbitterte Diskussionen zu.
Doch wie kann die Lösung in einer multikulturellen, zersplitterten, um ihre Werte ringenden Gesellschaft aussehen? Es gibt zwei Möglichkeiten: Dieser Zusammenprall der Kulturen macht uns sensibler, aufmerksamer im Umgang miteinander und lässt beispielsweise neue, von der Akzeptanz des jeweils anderen getragene Begrüßungsrituale entstehen. Oder: Die Debatte trägt in einer durch Migrationskrise und Terroranschläge ohnehin aufgeheizten Atmosphäre noch mehr zum Zwiespalt bei.
Es ist zu spät die Globalisierung aufhalten oder gar umkehren zu wollen, wie manche jetzt argumentieren werden. Jetzt müssen wir da durch. Und vielleicht beginnen wir damit, dass jeder Mensch die Position und die Sorge des anderen kennt und versteht. Auch meine.
Zum Shitstorm? Zur Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder nur einen Post.