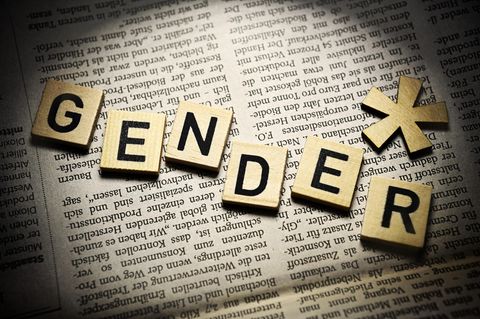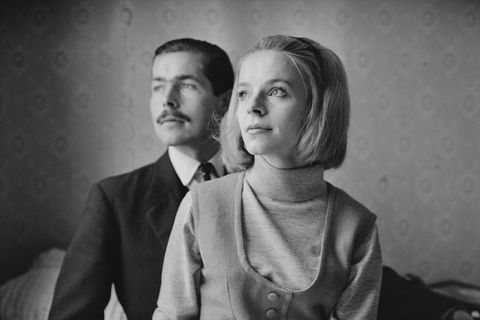Der Wahnsinn geschah am frühen Morgen. Mitglieder der Endzeit-Sekte Aum Shinrikyo ("Höchste Wahrheit") betraten an jenem 20. März 1995 mehrere Züge der Tokioter U-Bahn im Regierungsviertel. Mit geschärften Regenschirmspitzen stachen sie in Plastiktüten mit Sarin und setzten das tödliche Nervengas frei. Die Bilder von Menschen mit blutigem Schaum vor dem Mund gingen damals um die Welt. Zwölf Menschen starben, mehr als 5500 wurden verletzt. Heute, zehn Jahre später, müssen viele der Opfer des Anschlages weiter unter den psychischen, physischen und finanziellen Folgen leiden. Sie werfen der Regierung vor, sie schlicht im Stich gelassen zu haben.
"In den vergangenen zehn Jahren haben wir immer wieder Forderungen nach staatlicher Hilfe erhoben. Doch bis auf den heutigen Tag hat die Regierung kaum einen Finger gekrümmt, um uns zu helfen", klagte Shizue Takahashi gegenüber der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo. Ihr Mann hatte an jenem Tag als Bahnhofsbeamter die Tüten mit dem Nervengas hoch genommen und war kurz darauf gestorben. Heute leitet seine Witwe eine Selbsthilfegruppe von Opfern und deren Angehörigen. Jeder hätte dem Anschlag zum Opfer fallen können, sagen sie. Doch aus Sicht der Regierung hätten sie einfach bedauernswertes Pech gehabt.
Spirituelles Vakuum in den Boom-Jahren
Mit dem Attentat wollte die Sekte eine geplante Razzia der Polizei gegen ihr Hauptquartier am Fuße des heiligen Berges Fuji verhindern. Der halb blinde Sektengründer Shoko Asahara hatte das spirituelle Vakuum genutzt, das nach den wirtschaftlichen Boom-Jahren in Japan entstanden war und die junge Generation zu neuen Religionen wie Aum trieb. Doch statt die Hintergründe der gesellschaftlichen Katastrophe tiefgehend zu analysieren, wurde Asahara laut Kritikern nur zu einem unmenschlichen - und damit nicht japanischen - Monster gestempelt. Unschuldige Mitläufer wurden zu Staatsfeinden erklärt.
Vor einem Jahr verurteilte ein Gericht Asahara, mit bürgerlichem Namen Chizuo Matsumoto, wegen des Sarin-Anschlags und anderer Verbrechen zum Tode. Mit ihm wurde der letzte von 189 Angeklagten verurteilt, davon zwölf zum Tod. Keines der Todesurteile wurde bisher vollstreckt. Auch Asaharas Verteidiger legten Berufung ein, womit sich der seit Jahren andauernde Jahrhundertprozess hinziehen dürfte. Derweil stehen die rund 1650 Jünger der Sekte, die sich in Aleph umbenannt und von Gewalt losgesagt hat, unter scharfer Überwachung.
Manche Opfer konnten sich aus der Konkursmasse einiger Firmen der Sekte in Zivilprozessen bescheidene Entschädigungssummen erstreiten. Die Regierung jedoch bewege sich bezüglich dringend benötigter Finanzhilfen sowie medizinischer und psychologischer Versorgung für Tausende von Opfern nach wie vor nur im Schneckentempo. Die Angehörigen hätten von ihrer Regierung gern die gleiche, umfassende Hilfe, wie sie die Opfer der Terroranschläge des 11. September von der US-Regierung bekämen. Die Aum-Sekte habe das System, die Regierung im Visier gehabt, sagte ein Mann, dessen Schwester bei dem Anschlag fast völlig gelähmt wurde und deren mentale Fähigkeiten infolge des Sarins auf die eines Kleinkindes reduziert wurden.
Posttraumatische Belastungsstörungen
Andere leiden noch immer unter Augenproblemen, Kopfschmerz und posttraumatischen Belastungsstörungen mit Symptomen wie Übelkeit, Angstattacken und Schlaflosigkeit. "Was wir tun, ist etwas, was eigentlich die Regierung machen sollte nicht eine private Gruppe wie wir", sagt ein Vertreter des Recovery Support Center in Tokio. Die Organisation kümmert sich mit jährlichen kostenlosen medizinischen Untersuchungen um die Opfer.