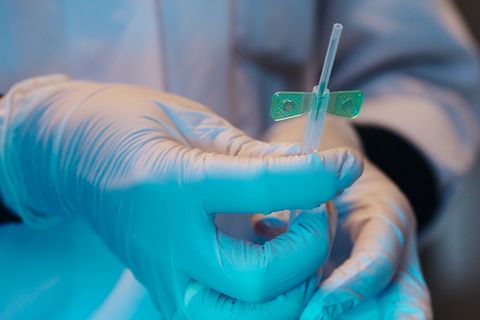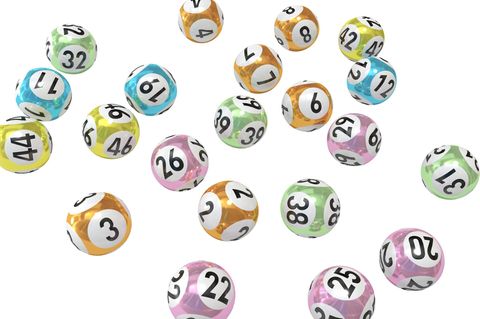Wer zu Weihnachten im trägen Kreis der plätzchendicken Verwandtschaft einen Streit vom Zaun brechen will, könnte es mit folgendem Satz versuchen: "Ich finde, diese ganze dreckige Silvesterknallerei sollte ein für alle Mal verboten werden, wegen Umwelt und Klima." Die Diskussion dürfte heiß werden – beim Thema Silvesterfeuerwerk sind die Deutschen empfindlich.
Großzügig sind die Deutschen ebenfalls: Rund 180 Millionen Euro haben sie ausgegeben, um am Jahreswechsel 2023/24 mit Blisterpackungen voller Böller und Raketen in die Straßen auszurücken. Vor allem Männer wollen die Knallerei beibehalten.
Leidet die Natur wirklich nachhaltig darunter? Ja, sagt das "Aktionsbündnis für ein böllerfreies und friedliches Silvester", dem 30 Organisationen von der Deutschen Umwelthilfe bis zur Bundesärztekammer angehören. Private Feuerwerke seien sofort zu verbieten.
Die größte Belastung des Treibens entsteht durch die temporäre Luftverschmutzung. Laut Umweltbundesamt werden in Deutschland jährlich rund 2050 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt, der größte Teil davon in der Silvesternacht. Das entspricht knapp einem Prozent der gesamten Feinstaubmenge eines Jahres. Nicht dramatisch viel, aber durchaus relevant.
Silvester und die Ökobilanz: Wie Feuerwerk die Feinstaubwerte explodieren lässt
Wie sich die Luft schlagartig auffüllt, kann man auf der Seite des Umweltbundesamts (UBA) eindrucksvoll nachvollziehen. Eine Animation zeigt die Silvesternacht 2023/24. Um ein Uhr, also früh am Neujahrstag, ist die Feinstaubkonzentration am höchsten. Dann geht sie langsam zurück, bis sie gegen Mittag wieder Normalwerte erreicht. Wenn es regnet oder der Wind weht, beschleunigt sich der Abbauprozess.
Die höchste Konzentration der Nacht findet sich übrigens nicht im Ruhrgebiet, sondern in Bayern, Baden-Württemberg sowie Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen.
Mancherorts schießt die Feinstaubkonzentration auf mehr als 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m³) im Stundenmittel hoch. Das sind rund 66-mal mehr als der Durchschnitt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert als erträglichen Grenzwert 45 μg/m³. Allerdings bewerten Ärzte eine kurzzeitige Belastung durch zu viel Feinstaub als tolerierbar. 35 Überschreitungstage im Jahr sind zulässig.
Das Klima beeinflusst der Luft- und Bodenkrawall nicht besonders. Die CO₂-Belastung ist statistisch eher zu vernachlässigen. Laut Umweltbundesamt werden durch Feuerwerkskörper 1150 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente freigesetzt, was 0,00013 Prozent der jährlichen deutschen Treibhausgasemissionen entspricht. Andererseits könnte man argumentieren: Jedes gesparte Gramm zählt.
Müllberge nach Mitternacht
Bleibt das Thema Müll. Am Neujahrsmorgen ist das Land übersät mit Plastik-, Ton-, Pappe- und Holzresten. Der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk beschwichtigt, Silvestermüll mache nur 0,05 Prozent der Abfalljahresmenge eines Haushalts aus. Außerdem seien Feuerwerkskörper zu 90 Prozent biologisch abbaubar. Aber zehn Prozent sind es nun mal nicht. Diese Kunststoffe belasten die Böden über Jahrzehnte.
Als Fazit wäre zu sagen: Für Umwelt und Klima ist Silvester keine Katastrophe. Harmlos sind die Schwarzpulverorgien aber keineswegs. Die geschundene Mutter Erde könnte ohne Zweifel gut darauf verzichten.
Man könnte in der Diskussion ums Feuerwerksverbot noch andere Verbalraketen zünden. Etwa durch Hinweise auf die unzähligen Böller-Versehrten zwischen den Jahren. Oder auf die zweifelhafte Ästhetik einer grellen Boden- und Luftoffensive mit Sektbegleitung angesichts der brutalen Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten.
In diesem Sinne: Prost Neujahr schon einmal.