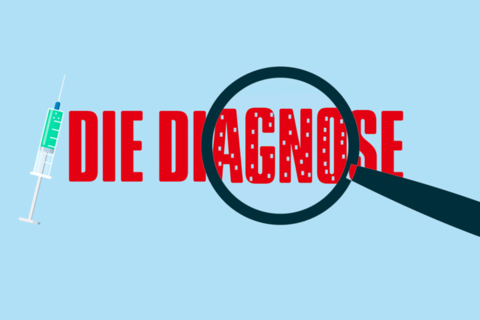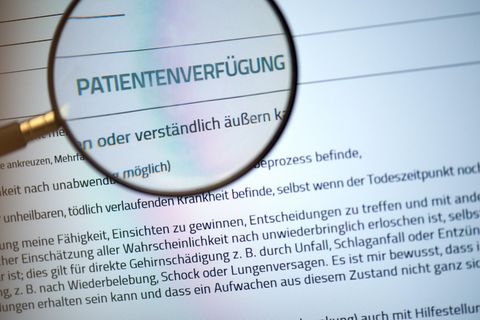Britischen und belgischen Wissenschaftlern ist es gelungen, mit einem Wachkoma-Patienten zu kommunizieren. Dazu bildete das Team die Hirnaktivität des Patienten mit Hilfe der sogenannten funktionellen Kernspintomographie ab, wie die Forscher im US-Fachblatt "New England Journal of Medicine" (online vorab) berichten.
Die Bilder zeigten Anzeichen von Bewusstsein bei dem Mann, der bislang als völlig von der Welt abgeschlossen galt. Dem heute 29-Jährigen, der 2003 bei einem Verkehrsunfall schwerste Kopf- und Hirnverletzungen erlitten hatte, wurde eine Reihe von Fragen gestellt. Vorher wurde die Hirnaktivität des Mannes gemessen, während er sich Szenen vorstellen sollte, bei denen unterschiedliche Hirnbereiche aktiv werden. Und zwar entweder ein Tennisspiel, bei dem immer wieder der Arm bewegt wird, um den Ball zu schlagen. Oder einen Gang durch bekannte Straßen oder Räume, bei denen er sich die Umgebung möglichst genau vorstellen sollte. Diese zwei Szenerien wurden dann später als Antwortmöglichkeiten genutzt: Tennisspiel für "Ja", Spaziergang für "Nein".
Der Patient beantwortete so fünf von sechs Fragen der Wissenschaftler richtig. Der junge Belgier bestätigte zum Beispiel, dass der Name seines Vaters Alexander ist. Und er verneinte, dass der Name seines Vaters Thomas ist. Die Forscher, die die Fragen stellten, wussten vorher nicht, welche Antwort stimmte.
40 Prozent Fehldiagnosen
Die Wissenschaftler betonen in dem Fachaufsatz, dass es sich um eine seltene Ausnahme handelt. Sie hatten insgesamt 54 Patienten in Belgien und Großbritannien untersucht. Fünf konnten willkürlich ihre Hirnaktivität beeinflussen. Bei dreien davon stellten die Ärzte schwache Anzeichen von Bewusstsein fest. Nur der 29-jährige Belgier konnte rudimentär kommunizieren. Und dies sei auch nur im Hirnscanner möglich gewesen. Am Krankenbett blieb jede Kontaktaufnahme erfolglos.
An der Untersuchung waren Wissenschaftler der Universität Cambridge und der belgischen Universität Liège beteiligt. Die genaue Unterscheidung schwerer Bewusstseinsstörungen sei sehr schwierig, betonen sie in ihrem Aufsatz. Die Rate der Fehldiagnosen betrage ungefähr 40 Prozent. Neue Methoden seien daher gefragt, um die etablierten Untersuchungen zu ergänzen. Adrian Owen, Wissenschaftler der Universität Cambridge, betonte zudem, dass das neue Verfahren Möglichkeiten eröffnen könnte, Patienten in Entscheidungen über künftige Behandlungen einzubeziehen und sie beispielsweise nach ihren Schmerzen zu fragen, um sie entsprechend zu behandeln. Das könnte die Lebensqualität der Betroffenen verbessern.