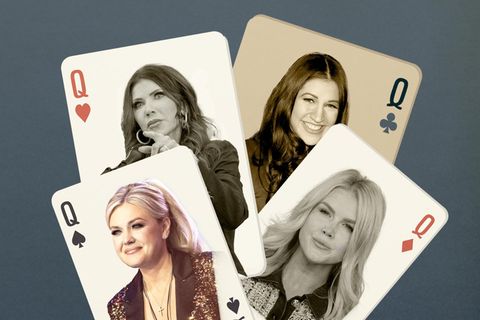Die halbe Republik diskutiert nach der Großspende des Milliardärs August von Finck an die FDP über die deutsche Parteispendenpraxis. Und prompt denkt Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) über ein kleines Reförmchen nach.
Okay, der Ausdruck Reförmchen ist relativ gnädig. Immerhin, wie man auf den Bundestagsfluren flüstert, überlegt der Parlamentspräsident, die Großspenden an die Parteien, die 50 000 Euro überschreiten, rascher zu veröffentlichen. Heute vergeht zum Teil mehr als ein Monat, bis Lammert solche Spenden publik macht, nachdem die Parteien sie bei ihm gemeldet haben. Und er
veröffentlicht sie immer nur gesammelt, einmal im Monat. Das müsse eben alles "durch die Verwaltungsregeln laufen", erläutert ein Parlamentssprecher diese Praxis in vagen Worten.
Jetzt überlegt der Präsident, diese Informationen rascher herauszugeben. Das ist ein erster Schritt. Viele weitere müssten folgen. Wenn Lammert schon Transparenz demonstrieren will, könnte er außerdem die Präsentation der Spendenberichte auf der Bundestagswebsite überarbeiten. Der normale Bürger hat dort kaum eine Chance, zu den Namen und Zahlen zu kommen. Nicht auf der Startseite
und noch nicht mal auf der Sitemap gibt es den kleinsten Hinweis auf Parteispenden. Als ob es die gar nicht gibt und der Bundestag dafür gar nicht zuständig wäre.
Der mündige Bürger, der danach sucht, muss auf der Bundestagssite erst auf "Dokumentation & Recherche" klicken, dort auf "rechtliche Grundlagen", dann runterscrollen bis "Parteiengesetz" - und findet
hier schließlich den Link zur "Finanzierung" mit den Rechenschaftsberichten der Parteien und den gemeldeten Großspenden. Nur Mut, manchmal funktionieren dann sogar die Links zu den einzelnen Berichten. Auf die Idee, die Angaben über eine nach Spender- und Empfängernamen durchsuchbare Datenbank zu präsentieren, kam man im Hause Lammert bis heute nicht. Logisch, das Internet ist ja doch noch eine relativ junge Erfindung.
Statt die Spendendaten zu veröffentlichen, versucht der Bundestag sie bis heute offensichtlich eher zu verschleiern. Apropos Schleier und überhaupt: Die deutschen Parteien haben die Transparenz der Parteispenden tatsächlich so geregelt, dass sie eher einer Burka gleicht, als einem Bikini.
Lammert behauptete zwar dieser Tage, die hiesige Parteispendenpraxis gelte "international als vorbildlich". Doch diese Meinung wird international leider weniger geteilt. Erst vor wenigen Wochen kritisierten sowohl Europarat wie OSZE die geringe Transparenz des deutschen Spendenwesens. Schade, dass der Parlamentspräsident offenbar keine Zeitung liest und sich auch
nicht dafür interessiert, wie das alles in den Mutterländern der Demokratie geregelt wird.
Zum Beispiel in den USA oder Großbritannien. In beiden Staaten müssen die Parteien ihre Spenden vierteljährlich melden, nicht jährlich wie bei uns. Und während bei uns die Rechenschaftsberichte mit den Spendernamen unter 50 001 Euro erst mit zwei Jahren Verspätung veröffentlicht werden, stellen Briten und Amerikaner die Reports immer sofort online. Aber das Internet ist ja noch eine relativ junge... siehe oben!
Nur in Frankreich werden Spendernamen gar nicht online gestellt. Aber links des Rheins sind Parteispenden über 7500 Euro pro Jahr ganz verboten. Eine solche Obergrenze haben wir nicht. Genauso wenig wie ein Verbot von direkten Unternehmensspenden an Parteien und Politiker. Das haben aber Frankreich und die USA. Ja, es gilt in den USA auch nach dem jüngsten Urteil des Supreme Court, das Firmen wieder erlaubt, politische Kampagnen zu finanzieren.
In den USA ist der Schwellenwert, ab dem Spendernamen publik gemacht werden, übrigens weiterhin bei 200 Dollar. Genau, 200 Dollar. Bei uns: 10 000 Euro.In England liegt er bei 5000 Pfund für Parteien und 1000 Pfund für einzelne Abgeordnete. Für einzelne Abgeordnete gilt bei uns dagegen ebenfalls der absurd hohe Schwellenwert von 10 000 Euro. Bis zu dieser Summe darf man - pro Jahr - deutschen Abgeordneten das Geld in aller Heimlichkeit und als Bargeld überreichen. Und anders als in den meisten Ländern Europas ist Abgeordnetenbestechung bei uns bis heute nicht umfassend verboten, obwohl das eine von der Bundesrepublik mitgetragene UN-Konvention verlangt.
Trotzdem ertönt es in Berlin immer wieder im Chor, die deutsche Politik sei nicht käuflich. Nur dass das immer wenige glauben. "Sind unsere Politiker käuflich?", fragte der ARD-Presseclub auf seiner Website am Wochenende. 95,76 Prozent antworteten mit Ja. 4,24 Prozent sagten Nein.
Das war keine repräsentative Umfrage, gewiss. In Berlin arbeiten viele ehrliche Politiker, ganz bestimmt. Aber man würde den Unschuldsbeteuerungen doch noch mehr glauben, wenn das Politikerkaufen endlich richtig verboten würde. Oder wenn es leichter wäre herauszufinden, was deutsche Abgeordnete an frommen Gaben so alles bekommen.
Nicht so schüchtern, Herr Lammert! Streifen Sie die Burka ab!