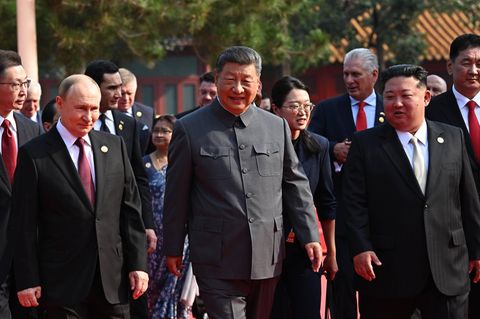"Habt ihr die Berge gesehen?", fragt Herr Zhang staunend. Obwohl die Hügelkette im Westen noch innerhalb der Stadtgrenzen liegt, sieht man sie sonst, der dicken Luft wegen, nur selten. Dieser Tage aber zeichnen zumindest ihre Silhouetten sich regelmäßig ab.
"Der Mond ist auch wieder da!", freut sich Herr Liu, "den habe ich zwei Jahre lang nicht mehr gesehen". Tatsächlich war das womöglich der größte Spezialeffekt der Olympia-Regisseure: dass sie den Mond wieder zum Vorschein brachten. Drall und gelb wie ein Lampion hing er Nacht für Nacht über der Stadt. "Fehlen nur noch die Sterne", schaltet Herr Jiang sich ein. "Aber ob wir die noch einmal sehen werden?"
Über den Autor
Stefan Schomann, geboren 1962, freier Autor und Reporter, lebt in Berlin und Peking. Zuletzt erschien sein Buch "Letzte Zuflucht Schanghai" im Heyne Verlag, eine wahre Geschichte aus den vierziger Jahren, über die Liebe zwischen einem jungen jüdischen Emigranten und einer Chinesin aus gutem Hause.
Mehr über ihn unter www.autoren-reporter.de
Die drei Herren, alle um die sechzig, dürften glaubwürdigere Wetterchronisten sein als amtliche Messstationen und Statistiken. Seit dreißig, vierzig Jahren leben sie erstaunlich standorttreu in einem Hutong am Südrand des Zentrums, einer jener von Wohnhöfen gesäumten Gassen, die zunehmend der Hochhausbebauung weichen müssen. Zhang hat ein lädiertes Fahrrad vorbeigebracht, Meister Liu repariert es, und Nachbar Jiang sieht zu. Lius Werkstatt besteht aus einem Werkzeugkasten und einer roten Matte am Rand der Gasse. Ein kleines Handtuch als Schweißfänger um Hals, die Fluppe im Mundwinkel, räsoniert er über das Wettergeschehen.
Früher habe es mehr geregnet und geschneit; die Stadt sei heißer, wüstenhafter geworden. "Daran sind die Klimaanlagen schuld", meint Nachbar Jiang. Mit ihrer Abluft heizten sie die Stadt zusätzlich auf, von all den anderen elektrischen Geräten nicht zu reden. In seiner Jugend wären nur ganz wenige Nächte so schwül gewesen, dass man nicht hätte schlafen können. Bis in die achtziger Jahre sorgten allein große Fächer aus Bananenblättern für Kühlung. In den Neunzigern erst kamen zunächst Ventilatoren auf und dann die heute allgegenwärtigen Klimaanlagen. Nur die Bewohner der spartanischen Hutongs müssen ohne sie zurechtkommen; hier gibt es auch nur Gemeinschaftstoiletten für die ganze Gasse.
Unterm chinchillagrauen Wolkenpelz
Jeden Tag greift Jiang sich sein Schemelchen und setzt sich nach draußen, weil es drinnen zu heiß ist. Alle drei gehen, typisch für das alte Peking, im Unterhemd und mit schlurfenden Schlappen aus, ganz wandelnde Gelassenheit. Und sind so tadellos schlank, wie man es wohl nur durch die Verbindung von richtiger Ernährung und regelmäßigem Rauchen wird.
Bis zu seiner Pensionierung arbeitete Jiang in einer jener chemischen Fabriken, die für Olympia weit vor die Tore der Stadt verbannt wurden. Eine von zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Luft und der Lebensqualität, die in den letzten zehn Jahren durchgedrückt wurden. Mit spektakulärem Erfolg; selbst Greenpeace bescheinigte der Stadt einen umweltpolitischen Durchbruch.
Kaum ein anderes Thema wurde im Westen vor Olympia so eingehend erörtert wie die Luftverschmutzung - während Athen bekanntlich ein Kurort war und London der Inbegriff hochsommerlich-heiteren Klimas sein wird. Den Athleten wurde gar geraten, Atemmasken mitzunehmen. Als 30.000 Journalisten in Peking eintrafen, viele von ihnen das erste Mal, zeigten sie sich pflichtgemäß bestürzt, als es ein paar Tage lang grau und diesig war. Das Olympiastadion lag unter dem düsteren Himmel wie ein Schlauchboot im Eismeer, und die Olympische Flamme erinnerte an den Abluftkamin einer Raffinerie, die zischend überschüssiges Gas abfackelt. Schrecklich, diese Luftverschmutzung!
Doch so ist das Wetter hier andauernd. Oft hängt tagelang ein chinchillagrauer Wolkenpelz über der Stadt, als wäre eine Zwischendecke eingezogen worden. Das hat jedoch zunächst nichts mit Umweltverschmutzung zu tun, sondern mit Geographie, und die ist bekanntlich Schicksal.
"Die Olympiade hat uns den Himmel zurückgegeben"
Peking liegt am Nordrand einer subtropischen Zone, die durch ein extremes Ostseitenklima geprägt ist. Im Sommer heizt sich die asiatische Landmasse stark auf, so dass über der Küste ein Hitzetief entsteht, in das Monsunwinde einströmen. Eine alles durchdringende, alles beherrschende Schwüle regiert, und die Luft fühlt sich an wie feuchte Glut. In der Tat stellt der ewig verhangene Himmel einen der gravierendsten Gründe gegen ein Leben in China dar, neben der Tatsache, dass die Leute hier allen Ernstes warmes Wasser trinken, und dass es keinen Frühstücksquark gibt.
Die Luftverschmutzung kommt erschwerend hinzu, aber man kann dabei nicht unbedingt dem Augenschein vertrauen. Die Bronchien sind der bessere Indikator. Die vermeintlich grauen Olympiatage wurden denn auch vom Umweltamt mit Güteklasse I ("ausgezeichnet") eingestuft, während heiterere Tage mit II ("gut") oder einmal auch mit III ("befriedigend") abschnitten. Schlechter wurde es nie - die besten Werte seit zehn Jahren! Herr Zhang meint gar, seit den Siebzigern wäre der Himmel nicht mehr so schön blau gewesen. Oder zumindest bläulich. "Die Olympiade hat uns den Himmel zurückgegeben."
Das Wetter ist in China seit alters her Chefsache
Mehrmals im Jahr machte sich der Kaiser, eskortiert von prunkvollem Gefolge, von der Verbotenen Stadt auf zum Himmelstempel. Auf der gleichen Strecke begann am Sonntag der Marathon. Barfüßig betrat der Sohn des Himmels die heiligen Hallen, warf sich zum Kotau nieder und betete um reiche Ernte, genügend Regen und Ruhe im Reich.
Wenn selbst etwas so Ungebärdiges wie die Gesellschaft sich regulieren lässt, warum nicht auch die Witterung? Zumal uns heute andere Mittel zur Verfügung stehen als nur magische Rituale. Und so überließen die Olympia-Planer auch das Wetter nicht dem Zufall. Sondern Dr. Hu Guo. Dem Direktor des Pekinger Wetterdienstes und Leiter der Olympischen Meteorologie.
Anders als seine Kollegen im Westen braucht er die Launen des Wetters nicht passiv zu erdulden - er kann es selbst beeinflussen. Mittels einer rund um die Stadt postierten Artillerie kann er Regenwolken bei Bedarf verscheuchen oder vorzeitig entleeren. Bei solch einem High-Tech-Schamanen erwartet man unwillkürlich eine donnernde Stimme, schließlich gebietet er den Elementen. Doch Guo spricht leise und piepsig. Er ist Wissenschaftler und nicht daran gewohnt, dass die Weltöffentlichkeit an seinen Lippen hängt. Mehrfach betont er, dass der Regen vom letzten Donnerstag ausschließlich natürliche Ursachen hatte. Nur einmal, vor der Eröffnungsfeier, habe sein Team vorsorglich eingegriffen - mit Erfolg. Und Erfolg ist auch in China das Einzige, was zählt. Während der Olympischen Spiele jedenfalls hat das Wetter den Plan übererfüllt.
Heute, am Tag danach, ist der Himmel diesig, das Licht diffus, und der Verkehr rollt oder vielmehr stockt wieder wie gehabt. Am Nachmittag erhält Professor He Kebin, Umweltingenieur und Mastermind des Zehnjahresplans zur Luftverbesserung in Peking, einen Anruf vom Bürgermeister. "Das Wetter während der Spiele war großartig! Was können wir tun, damit es so bleibt?"