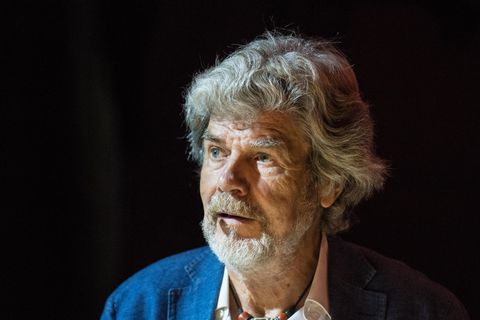Herr Messner, lassen Sie uns über die Südtiroler Berge sprechen. Sie selbst sind im Villnöß-Tal aufgewachsen, mitten in den Dolomiten. Welchen Ort erinnern Sie am liebsten?
Die Gschnagenhardt Alm. Sie liegt auf einem Waldhügel, davor eine freie Wiese. Dort haben wir im Sommer viele Wochen verbracht, ein freies und wildes Leben geführt. Wir Kinder haben auf die Geislerspitzen geschaut und gesagt: Diese Zacken wollen wir besteigen. Mit 12 Jahren kannte ich jede Rinne in den Felsen. Das Gelände ist ziemlich brüchig – so lernt man gut klettern.
Später haben Sie diese Künste gut anwenden können. Sie sind jede große Wand der Dolomiten geklettert, haben viele neue Routen erschlossen.
Unser Weg war: Mit so wenig Gepäck wie möglich große und lange Klettereien zu machen. Das war ein Abenteuer: Sind wir auf dem richtigen Weg, haben wir uns verstiegen? Meine Theorie bleibt: Wenn du vom Berg nicht runterfallen kannst, ist es kein Berg, sondern eine Attrappe.
Was zeichnet die Dolomiten aus?
Rein von der Ästhetik her sind sie für mich die schönsten Berge der Welt. Jeder Berg hat einen eigenen Charakter, eine eigene Ausstrahlung. Durch die Besteigungen sind viele tausend Seiten in die Felsen geschrieben, durch die Linien, die die Kletterer gewählt haben.
Kann die Dolomiten nur der ganz verstehen, der sie erklimmt?
Man muss sie nicht besteigen, man muss nur einen Teil ihrer Geschichte kennen – wer sie kennt, wandert ganz anders durch die Dolomiten. Das Narrativ zu den Bergen ist mindestens so wichtig wie die Berge selbst. Etwa die Spuren des Ersten Weltkriegs, bis heute zu finden etwa in den Sextner Dolomiten: Hier fand der erste Hochgebirgskrieg statt. Eine fürchterliche Zeit: Die Soldaten sind da oben erfroren, haben Hunger gelitten, sind von Lawinen erschlagen worden. Die Natur hat den Menschen gezeigt, dass sie da nicht hingehören.
Die Berge gehören den Menschen nicht, es ist dort, im besten Sinne des Wortes, ein Niemandsland.
Der Berg gehört tatsächlich niemand, das ist das Schöne. Was will ich denn auch holen? Die Felsen krieg ich nicht runter, die kann ich nicht mitnehmen.
Sie selbst leben mittlerweile auch im Ort Sulden, am Fuß des höchsten Bergs von Südtirol, des Ortlers. Wie geht seine Geschichte?
Die Einheimischen, die Bergbauern sind lange Zeit nicht draufgestiegen. 1804 hat der damalige Erzherzog Johann von Österreich einen Preis ausgesetzt: Wer findet den Weg zum Gipfel? Dann ist ein Jäger, Josef Pichler sein Name, der in der Höhe schon viele Gämsen geschossen hatte, aufgestanden, hat gesagt: „Das Geld will ich erst hinterher“ und ist raufgestiegen. Er ist – wahrscheinlich – dem Weg der Gämsen gefolgt, die ja ausgezeichnete Kletterer sind.
Welcher ist Ihr Lieblingsberg in Südtirol?
Kann ich nicht sagen, aber ich mag Gipfel wie den der Königsangerspitze in den Sarntaler Alpen. Er ist eigentlich völlig unspektakulär, besitzt aber eine besondere Bedeutung. Er liegt auf einer Höhe, auf die man gut das Vieh treiben kann – das haben die Hirten schon vor vielen tausend Jahren gemacht. Die alten Schafwege sind heute die Pfade der Wanderer. Die Hirten hatten früher auf diesen Stellen ihre Kultplätze – darüber gab es nur noch die erhabenen Gipfel, denen gegenüber sie Bewunderung und Demut empfunden haben.
Sie haben die Berge als Gottheiten betrachtet?
Als göttliche Dimension. Mit den Worten von Friedrich Hölderlin: „Das Göttliche ist viel schöner als Gott.“ Wir reden von einer Zeit, die vor 8000 Jahren begann, noch vor dem Ötzi.
Wer zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel steht, hat das Gefühl, die Welt wird gerade frisch erschaffen.
Ja, das ist schon faszinierend. Jedes Kind ist da begeistert. Ein Erwachsener natürlich auch. Wir können uns nicht vorstellen, was die Hirten damals gedacht haben. Die Natur hatte generell eine heilige Dimension. Der Mensch ist so hoch gegangen, wie er Ressourcen holen konnte. Er hat die Tiere im Sommer bis über die Waldgrenze getrieben, weil die Gräser weiter oben mehr Nährstoffe hatten. Er hat nur gesehen, dass die Tiere stärker werden, wenn sie da oben sind.
Ist das Heilige in den Bergen noch spürbar?
Es kommt sehr auf die Stimmung an, Morgenlicht, Abendlicht, das Licht, wenn Wolken aufziehen. Die Romantiker haben die Bergen gleichzeitig als einladend und als auslandend beschrieben. Wir dagegen haben den Berg zum Sportplatz gemacht. Jetzt rennen alle Leute durchs Gebirge, sehen nichts, hören nichts, rennen nur. Oder fahren mit dem Mountainbike durch die Gegend. Das ist alles gut und recht, aber nicht der eigentliche Sinn. Der Ursprung war die Neugierde.
Wie oft gehen Sie selbst noch in die Berge?
Einmal in der Woche ziehe ich los, am liebsten dorthin, wo ich noch nie war. Es heißt immer, alles sei überlaufen, aber ich sehe meist niemand.