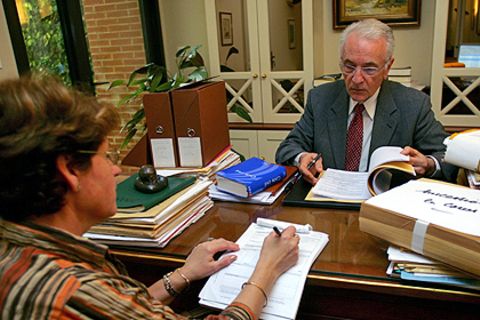Es kann einige Gründe geben, mit »warmer Hand« zu schenken, statt die Erben erst nach dem Tod zu beglücken. Natürlich gehört dazu, dass man noch die direkte Dankbarkeit erleben kann. Genauso wichtig ist aber, dass sich so geschickt Erbschaftssteuer sparen lässt. Zwar ist die Schenkungssteuer genauso hoch wie die Erbschaftssteuer (blöd ist der Gesetzgeber schließlich nicht), aber man kann alle zehn Jahre die Freibeträge neu nutzen.
Schenkung rückgängig machen
Viele Vermögende plagt einfach die Angst, dass sie eine etwaige Schenkung zu Lebzeiten später bereuen werden. Undankbare Kinder oder Verwandte, die sich dann plötzlich rar machen, geistern als Schreckgespenst durch die Fantasie. Auch eine plötzliche finanzielle Notlage, bei der man dann ohne sein Geldpolster dasteht bereitet Sorge. Diese Sorgen wollte der Gesetzgeber zerstreuen, man kann seine Schenkung rückgängig machen. Allerdings müssen dafür Gründe vorliegen: etwa 'grober Undank' beim Beschenkten. Meist gilt als grober Undank alles, was auch zu einer völligen Enterbung führen würde. Man hat auch nicht ewig Zeit dazu, sein Geschenk zurückzufordern: exakt ein Jahr, nachdem man vom Widerrufsgrund erfahren hat. Doch auch wenn der einstmals Großzügige nicht mehr selber für seinen Unterhalt aufkommen kann, darf er das Geschenk zurückfordern. Hier gibt es zwei Einschränkungen: Das Geschenk muss noch existieren, und es darf nicht länger als zehn Jahre her sein, dass es gemacht wurde. Sonst gilt auch hier: »Geschenkt ist geschenkt«.
Zauberwort »Freibetrag«
Trotz aller Risiken kann eine Schenkung zu Lebzeiten steuerlich interessant sein - besonders, wenn Kinder oder der Ehegatte bedacht werden sollen. Denn obwohl ja Erbschafts- und Schenkungssteuer gleich hoch sind, gibt es dabei einen 'Trick': Es wird immer alles, was innerhalb von zehn Jahren durch Schenkung (oder Erbschaft) erworben wurde, für den Freibetrag zusammengerechnet. Ältere Zuwendungen bleiben dabei unberücksichtigt, man kann die Freibeträge also alle zehn Jahre neu ausnutzen. Dabei gelten folgende Freibeträge: für Ehegatten 307.000 Euro, für Kinder 205.000 Euro, Enkelkinder 51.200 Euro, Eltern und andere Beschenkte je nach Steuerklasse von 10.300 oder 5.200 Euro.
Beispiel:
Vater Abraham schenkt seiner Tochter Monika zur Hochzeit 300.000 Euro. Dafür wird zwar Schenkungssteuer fällig, aber nur für die Höhe des Differenz zum Freibetrag, also 95.000 Euro. Der Steuersatz dafür liegt bei 7 Prozent, macht also 6.650 Euro. Nach 15 Jahren stirbt der Vater und hinterlässt seiner Tochter nochmals 300.000 Euro. Monika muss zwar Erbschaftssteuer zahlen, aber wieder nur für 95.000 Euro, denn auch im Falle der Erbschaft liegt ihr Freibetrag bei 205.000 Euro. Da die Steuersätze bei Erbschaft und Schenkung gleich hoch sind, muss sie also wieder 6.650 Euro zahlen. Insgesamt betrug ihre Steuerlast also 13.300 Euro. Hätte Monikas Vater ihr vor seinem Tod nicht geschenkt und hinterher die gesamte Summe auf einen Schlag vermacht, würde die Rechnung anders aussehen: Monika hat immer noch einen Freibetrag von 205.000 Euro, muss jetzt aber plötzlich den Differenzbetrag von 395.000 Euro versteuern. Da die Summe höher ist, steigt auch der Steuersatz: nun sind es schon 15 Prozent. Monika muss also in diesem Fall 59.250 Euro an Steuern zahlen. Ein Unterschied von 45.950 Euro - da lohnt sich das Nachdenken...
Erbschaftssteuer
Die Besteuerung orientiert sich an drei einfachen Grundsätzen:
* Größere Vermögen werden prozentual stärker besteuert als kleine;
* der überlebende Ehegatte und die nächsten Verwandten zahlen weniger Steuern als entfernte Verwandte oder »beliebige Dritte« (selbst, wenn es der Lebenspartner ist);
* die so genannten Freibeträge sind von der Besteuerung ausgenommen;
* die Höhe der Freibeträge bestimmt sich nach der Nähe der Verwandtschaft, auch die Natur des Vererbten (etwa Betriebsvermögen oder nur Hausrat) spielt eine Rolle.
Überblick der Steuerklassen
Bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer gibt es nur noch drei Steuerklassen. Darunter fallen:
Steuerklasse I
* Ehepartner 307.000 Euro
* Kinder und Stiefkinder 205.000 Euro
* Enkelkinder nur, wenn der Elternteil (also Kind/Stiefkind) verstorben ist 205.000 Euro
* alle anderen Enkel, Stiefenkel, Urenkel 51.200 Euro
* Eltern und Großeltern bei Erwerb von Todes wegen 51.200 Euro
Steuerklasse II
* Eltern und Großeltern bei Zuwendungen unter Lebenden
* Geschwister
* Nichten und Neffen
* Stiefeltern
* Schweigerkinder, Schwiegereltern
* geschiedener Ehepartner 10.300 Euro
Steuerklasse III
* alle übrigen Erben und Beschenkten (auch nichteheliche Lebenspartner) 5.200 Euro
Nachteile für Lebenspartner
Der nichteheliche Lebensgefährte gehört steuermäßig ganz klar zu den Verlierern: Er gehört einerseits in die Gruppe mit dem geringsten Freibetrag von »nur« 5.200 Euro. Andererseits wird ihm durch die hohen Steuersätze auch besonders viel vom Finanzamt abgeknöpft. Um den Partner vernünftig abzusichern, muss man sich also durchaus etwas einfallen lassen: Erben gemeinsame Kinder ein Haus, kann ihm das Wohnrecht darin eingeräumt werden. Auf jeden Fall sollte man diese Probleme mit einem Steuerberater durchsprechen.
Tipp:
Die Steuerexperten der Verbraucherzentrale kennen übrigens noch einen Trick der steuerschonenden Absicherung von Lebensgefährten: die Lebensversicherung. Dabei sollte aber nicht der Fehler gemacht werden, den zu versorgenden Partner als Begünstigten einzutragen: Er müsste sonst statt hoher Erbschaftssteuer genauso hohe Schenkungssteuer berappen. Der Ausweg sieht so aus: Der Partner, der abgesichert werden soll, schließt selbst die Lebensversicherung ab und versichert quasi das Leben seines Partners. Er zahlt auch selbst die Beiträge (auch wenn das in Wirklichkeit nur pro forma geschieht). Dann ist er im Falle des Todes seines Partners Anspruchsberechtigter aus eigenem Vertrag und unterliegt keiner der beiden Steuerarten.