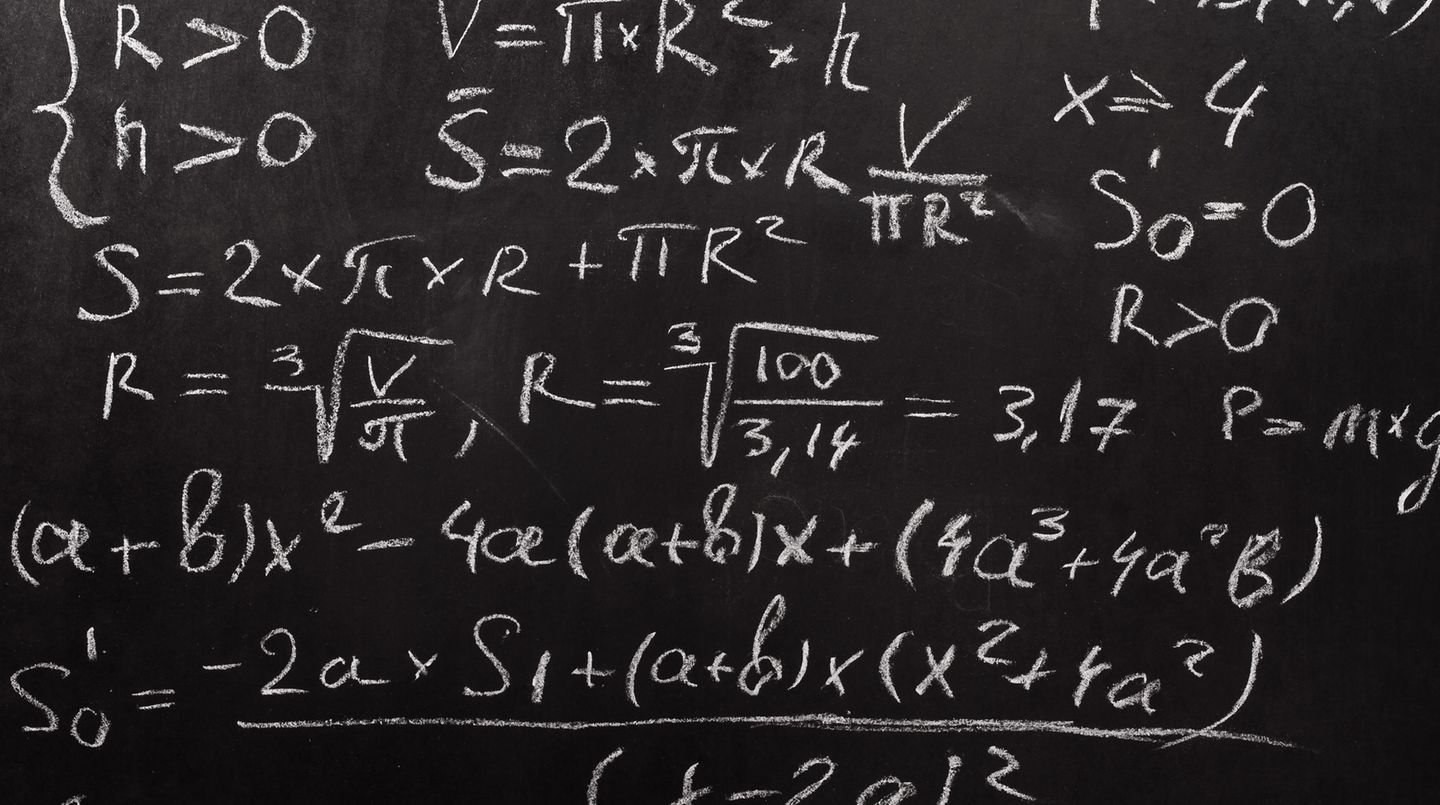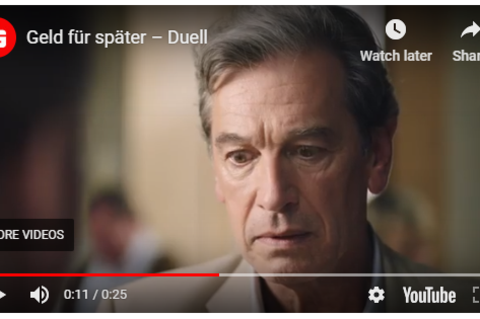Das Rentensystem in Deutschland gerät immer mehr in Schieflage. Deshalb hat die Bundesregierung reagiert und die "Rente mit 67" beschlossen. Seit Anfang 2012 wird das gesetzliche Renteneintritssalter schrittweise um zwei Jahre angehoben. Bis 2023 verschiebt sich der Rentenbeginn pro Jahr um jeweils einen Monat nach hinten, danach um jährlich zwei Monate - bis im Jahr 2029 das Renteneintrittalter von 67 Jahren erreicht ist. Die ersten, die zwei Jahre länger arbeiten müssen - wenn sie keine Abzüge bei der Rente wollen - sind Arbeitnehmer aus dem Geburtenjahrgang 1964.
Wer besonders lange in die Rentenversicherung eingezahlt hat, darf früher in den Ruhestand gehen, entschied die Bundesregierung. Ab dem 1. Juli 2014 können 63-Jährige abschlagsfrei in Rente, wenn sie 45 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Dabei werden auch Zeiten der Arbeitslosigkeit angerechnet, in denen Lohnersatzleistungen bezogen wurden. Dazu zählen etwa Arbeitslosengeld I, Kurzarbeitergeld oder Schlechtwettergeld. Der Bezug von Hartz IV-Leistungen wird nicht angerechnet.
Auch Selbstständige können mit 63 bei voller Rente in den Ruhestand eintreten, wenn sie 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben. Dafür müssen sie jedoch mindestens 18 Jahre pflichtversichert gewesen sein und in der restlichen Zeit als freiwillig Versicherte Rentenbeiträge gezahlt haben.
Arbeitnehmer, die ab dem 1. Juli 2014 aus gesundheitlichen Gründen in Ruhestand gehen, werden mit der Rentenreform besser gestellt. Ihrer Erwerbsminderungsrente werden künftig zwei zusätzliche Arbeitsjahre angerechnet. Das erhöht die Rente jedoch nur um durchschnittlich rund 40 pro Monat. Einen deutlicheren Vorteil für Erwerbsgeminderte bringt die "Günstigerprüfung". Sie soll verhindern, dass sich Erwerbseinbußen aus den letzten vier Arbeitsjahren, etwa durch Krankheit oder Teilzeitarbeit, negativ auf die Rentenleistung auswirken.
Der Renteneintritt mit 63 ist in der Übergangszeit bis 2029 möglich. Bis dahin wird die Altersgrenze für langjährig Versicherte auf 65 angehoben. Wer kürzer in die Rentenkasse eingezahlt hat, muss bis 67 weiterarbeiten.
Wie hoch aber ist nun eigentlich der gesetzliche Renten-Anspruch im Alter? Das errechnet sich aus der sogenannten Rentenformel. Sie besteht aus vier Faktoren: den Entgeltpunkten (E), dem Zugangsfaktor (Z), dem Rentenartfaktor (R) und dem jeweils aktuell gültigen Rentenwert (A) in Euro. Die Multiplikation dieser Faktoren ergibt die spätere monatliche Bruttorente, mathematisch lautet die Formel also: Rente = E x Z x R x A.
Im Folgenden erfahren Sie, was genau hinter den einzelnen Punkten steckt und wie sich Ihre Rente errechnen lässt.
Was bedeutet die "Renteninformation"?
Alle paar Jahre verschickt die Deutsche Rentenversicherung das sogenannte Renteninformationsschreiben an alle Versicherten. Eingerahmt in einem Kasten stehen die interessanten Zahlen: wie hoch die gesetzliche Rente voraussichtlich ausfallen wird. Drei Beträge werden dort genannt: 1. die Höhe der Rente, wenn man ab sofort aus gesundheitlichen Gründen erwerbsgemindert wäre, also wegen Krankheit oder Behinderung weniger als drei Stunden täglich arbeiten könnte, 2. der bereits erworbene Anspruch, also die künftige Rente, wenn man ab sofort keine Beiträge mehr leisten würde, 3. eine Prognose der Rente, wenn man weiter Beiträge wie in den vergangenen fünf Jahren zahlt.
Diese letzte Zahl ist die wichtigste, die Ihnen eine ungefähre Vorstellung von Ihrer künftigen Rente gibt. Die Prognose geht davon aus, dass es keine Rentenerhöhungen mehr gibt und dass Sie keine Einkommenssteigerungen erzielen, also künftig nicht höhere Beiträge zahlen. So ist dies eine konservative Schätzung, aber zur Vorsicht sollte man nur mit diesem Wert kalkulieren.
In dem Schreiben finden sich unter der Überschrift "Rentenanpassung" noch weitere, optimistischere Prognosen, die von einer jährlichen Steigerung von einem oder zwei Prozent ausgehen. Diese Hochrechnungen lassen sich aber nicht halten, wenn es - wie so oft - Nullrunden gibt. Stellen Sie sich also lieber auf die zurückhaltenden Schätzungen ein.
Was bedeuten die Entgeltpunkte?
Vereinfacht ausgedrückt hängen die Entgeltpunkte davon ab, wie viel man im Laufe des Erwerbslebens verdient und dementsprechend in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat. Entscheidend dafür ist zum einen die Anzahl der Beitragsjahre und zum anderen die Höhe des Einkommens. Für den Durchschnittslohn aller Versicherten in einem Jahr (2013: 34.071 Euro) gibt es den Entgeltpunkt 1,0. Dieser Wert erhöht oder verringert sich, wenn man über- oder unterdurchschnittlich verdient: Wer beispielsweise zehn Prozent über dem Durchschnittsverdienst des jeweiligen Jahres liegt, bekommt den Entgeltpunkt 1,1. Für die Hälfte des Durchschnittsverdienstes gibt es 0,5. Der maximal mögliche Wert schwankt um die 2,0 (abhängig von der jeweils gültigen Beitragsbemessungsgrenze).
Die Entgeltpunkte werden für jedes Jahr neu ermittelt und schließlich zusammengezählt. In bestimmten Fällen fließen auch noch Kindererziehungs- oder Ausbildungszeiten mit in die Berechnung ein.
Ab dem ersten Juli 2014 bekommen Eltern für die Erziehung für jedes Kind, das vor 1992 geboren wurde, einen Entgeltpunkt mehr. Für später geborenen Nachwuchs bleibt es bei drei Entgeltpunkten pro Kind. Für betroffene Personen im Ruhestand erhöht die Rentenversicherung die Rente automatisch. Wer noch arbeitet, kann die Erziehungszeiten beim Rentenantrag vervollständigen lassen.
Beispielberechnung für jemanden, der 40 Jahre lang zwanzig Prozent über dem Durchschnittsverdienst lag: E = 40 x 1,2
Die persönlichen Entgeltpunkte werden schließlich durch die weitere Multiplikation mit dem Zugangsfaktor (Z) ermittelt. Also: E = 40 x 1,2 x Z
Wovon hängt der Zugangsfaktor ab?
Der Zugangsfaktor hängt vom Renteneintrittsalter ab. Aktuell beträgt der Faktor 1,0, wenn bei Renteneintritt das gesetzliche Rentenalter erreicht ist. Für jeden Monat, den ein Arbeitnehmer früher aufhört, verringert sich der Faktor um 0,003 Punkte.
Beispielrechnung für jemanden, der ein Jahr, also 12 Monate, früher in Rente geht: Z = 1,000 - 12 x 0,003 = 0,964
Das Ganze funktioniert aber auch in die andere Richtung: Für jeden Monat, den ein Arbeitnehmer später in Rente geht, gibt es einen Aufschlag von 0,005 Punkten.
Beispielrechnung für jemanden, der ein Jahr später zu arbeiten aufhört:
Z = 1,000 + 12 x 0,005 = 1,060
Wichtig zu wissen: Die Anhebung des Renteneintrittsalters hat natürlich auch Auswirkungen auf den Zugangsfaktor. In der Übergangsphase zwischen 2012 und 2029 gilt der Faktor 1,0 jährlich für ein anderes Renteneintrittsalter.
Beispiele:
2014: Z = 1,000 = 65 Jahre + 3 Monate
2023: Z = 1,000 = 66 Jahre
2024: Z = 1,000 = 66 Jahre + 2 Monate
2025: Z = 1,000 = 66 Jahre + 4 Monate
2029: Z = 1,000 = 67 Jahre
Was ist der Rentenartfaktor?
Dieser Faktor ist von der Art der Rente abhängig. Bei der normalen Altersrente beträgt er 1,0. Für andere Rentenarten gelten zum Teil andere Werte, beispielsweise bei der Halbwaisenrente 0,1, bei teilweiser Erwerbsminderung 0,5 und bei Witwenrenten entweder 0,25 oder 0,55.
Wie wird der Rentenwert festgelegt?
Der Rentenwert wird nach einer komplexen Formel alljährlich zum Juli von der Bundesregierung neu festgelegt. Er entspricht der aktuellen monatlichen Rente, die gezahlt würde, wenn man ein Jahr lang die Beiträge für einen Durchschnittslohn gezahlt hätte. Ab Juli 2014 gelten folgende Rentenwerte: 28,61 Euro in den alten Bundesländern und 26,39 Euro in den neuen Bundesländern.
Beispielrechnungen
Für einen normalen Arbeitnehmer, der 45 Jahre lang in West-Deutschland ein Durchschnittseinkommen erzielt und entsprechende Rentenbeiträge gezahlt hat, ergibt sich 2014 somit folgende gesetzliche Rente:
E x Z x R x A = 45 x 1 x 1 x 28,61 Euro = 1287,45 Euro.
Jemand, der 40 Jahre lang 20 Prozent mehr als den Durchschnittsbeitrag gezahlt hat und ein Jahr verfrüht in Rente geht, bekommt:
(40 x 1,2) x (1 - 12 x 0,003) x 1 x 28,61 Euro = 1323,84 Euro.
Dies sind natürlich nur vereinfachte Beispielrechnungen. Der "normale Standardrentner" (auch "Eckrenter" genannt), der 45 Jahre lang durchschnittlich verdient und in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, kommt in der Realität wohl kaum vor. So verdienen viele Arbeitnehmer zu Beginn ihres Berufslebens häufig unterdurchschnittlich und später überdurchschnittlich.
Welche Unwägbarkeiten sollte man beachten?
Wer sich heute seine gesetzliche Rente in der Zukunft errechnet, sollte beachten, dass es ein paar Unwägbarkeiten gibt. Zum einen wird jedes Jahr der Rentenwert neu festgelegt. Er lässt sich zwar grob prognostizieren. Aber für den exakten Wert ist entscheidend, wie sich zum einen die Bruttolöhne entwickeln und zum anderen, wie sich das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern entwickelt. Diese und noch weitere Faktoren gehen in die sogenannte Rentenanpassungsformel ein, aus der sich jedes Jahr aufs Neue der Rentenwert errechnet. Es ist auch möglich, dass die Politik diese Formel ändern wird, wie in der Vergangenheit schon mehrfach geschehen.
Außerdem muss man die Inflation beachten: Von 1000 Euro kann man sich in 30 Jahren wegen der allgemeinen Preissteigerung (bei einer Inflationsrate von zwei Prozent) nur rund halb so viel leisten wie heute.
Und schließlich werden die Renten in Zukunft auch immer stärker besteuert. Im Gegenzug verringert sich die Steuerbelastung während der Berufszeit. 2005 begann die Besteuerung von 50 Prozent der Renteneinkünfte, seitdem steigt der Anteil jährlich um zwei Prozent, ab 2021 um ein Prozent, bis 2040 die Rente zu 100 Prozent besteuert wird. Das ist die aktuelle Gesetzeslage. Wie hoch für den einzelnen Rentner die steuerliche Belastung in weiter Zukunft aussehen wird, kann derzeit niemand seriös vorhersagen.