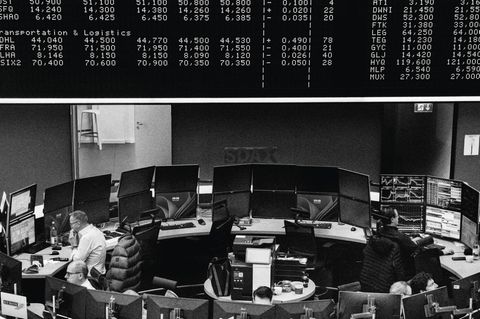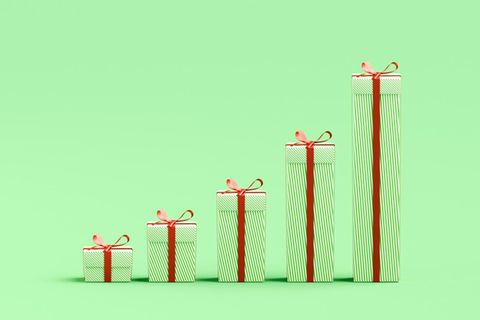In den Büros von Scalable Capital in München deutet nichts darauf hin, dass hier an der Zukunft des Anlagegeschäfts gearbeitet wird: weiße Räume, Neonlicht, schwarze PCs und an der Wand Fotografien langweiliger Landschaften, wie sie in langweiligen Möbelhäusern verkauft werden. Das einzige Start-up-Accessoire steht in der Küche: ein Kicker. Die Schmucklosigkeit gehört zum Konzept. "In unserer Branche geht es um Seriosität", sagt Florian Prucker. Vor zwei Jahren hat er zusammen mit Erik Podzuweit das Unternehmen gegründet. Sie wollen die Giganten der Branche angreifen – und dafür brauchen sie vor allem: das Vertrauen der Kunden.
Das Konzept der früheren Goldman-Sachs-Mitarbeiter mutet zunächst abenteuerlich an. Sie verwalten das Geld ihrer Anleger ausschließlich mithilfe eines Algorithmus. Dieser kauft und verkauft automatisch verschiedene Anlageprodukte und schichtet das Portfolio je nach Marktlage um. Nur sporadisch greifen Menschen ein.
"Robo-Advisor" heißt diese Form der digitalen Vermögensverwaltung, die aus den USA und Großbritannien stammt. Sie findet auch hierzulande immer mehr Nachahmer. Mittlerweile gibt es etwa ein Dutzend Anbieter, sie heißen Scalable oder Ginmon, Vaamo und Liqid, und sie alle versprechen eines: ordentliche Rendite zu niedrigen Kosten – denn wo Computer handeln, braucht es keine Bankberater, keine Honorare, keine Provisionen.
Brancheninsider gehen davon aus, dass die Start-ups bereits ein Vermögen von mehr als 300 Millionen Euro verwalten, Scalable betreut laut eigener Aussage einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Bis 2020 sollen nach Schätzungen der Unternehmensberatung Oliver Wyman deutschlandweit 30 Milliarden Euro von Maschinen angelegt werden.
Gerade Kleinanleger können von dieser Entwicklung profitieren. Bisher sind sie für große Banken als Kunden kaum interessant, weil kleine Vermögen zu wenig Gewinn abwerfen, als dass sich für sie eine individuelle Beratung mit marktüblichen Gebühren von etwa drei Prozent pro Jahr rechnen würde. Genau diese Zielgruppe sprechen viele der digitalen Vermögensverwalter an. Bei Vaamo können Sparer schon ab zehn Euro einsteigen. Die Grundgebühren liegen je nach Anlagevolumen und Anbieter zwischen jährlich 0,15 und 1 Prozent des angelegten Geldes – dadurch kann das Vermögen stärker wachsen als bei klassischen Vermögensverwaltern.
Die Maschine steuert das Risiko
Ein Konto bei einem Robo-Advisor ist schnell eröffnet. Anleger müssen sich meist mithilfe eines Scans ihres Personalausweises oder Reisepasses identifizieren und online mehrere Fragen beantworten. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage? Wollen Sie Ihr Vermögen erhalten oder deutlich steigern? Wie lange wollen Sie Ihr Geld anlegen? Welche negative Wertentwicklung würden Sie in einem schlechten Börsenjahr in Kauf nehmen? Und wie hoch ist Ihr frei verfügbares Vermögen? Aus den Antworten errechnet die Software ein Profil, nach dem sich dann die Anlagestrategie richtet – von konservativ bis risikoreich. Ähnlich macht es ein menschlicher Bankberater, nur nicht unbedingt so genau und transparent.
In hochspekulative Anlagen investieren die digitalen Vermögensverwalter ohnehin nicht. Sie konzentrieren sich auf Indexfonds, ETFs genannt, die auch die Verbraucherzentralen als Anlageprodukt empfehlen. ETFs sind besonders günstig, weil sie schlicht den Wertverlauf von Aktienindizes oder anderen Anlageklassen wie Staats- und Unternehmensanleihen oder Rohstoffen nachbilden. Entwickeln sich die4 jeweiligen Märkte positiv, steigt entsprechend der Wert der ETFs – und damit das Roboterportfolio. Gerade Einsteiger können von der Auswahl profitieren, sie brauchen kein Finanzexperte zu sein.
Wie die Maschinen ein Vermögen konkret verwalten und in welche ETF-Produkte sie investieren, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Scalable etwa setzt auf ein "Value at risk"-Modell: Je nachdem, wie viel jährliches Verlustrisiko Anleger akzeptieren, erhalten sie ein anderes Anlagepaket, 23 Risikostufen stehen zur Wahl. Der Algorithmus berechnet ständig die Risiken an den Märkten und schichtet das Portfolio entsprechend um. In turbulenten Marktphasen setzt er eher auf sichere Anleihen-ETFs, in ruhigeren Zeiten eher auf Aktien- und Rohstoff-ETFs. Dadurch soll das Verlustrisiko konstant gehalten werden.
Anbieter wie Ginmon und Vaamo verfolgen dagegen eine "Buy and hold"-Strategie. Im Gegensatz zu Scalable haben sie keine Lizenz der Bafin und treten nicht als Vermögensverwalter, sondern als Anlagevermittler auf – für Kunden ein zentraler Unterschied. Diese Unternehmen sind weniger reguliert und geben aus rechtlicher Sicht keine Empfehlungen ab, sie vermitteln nur. Der Kunde muss bei einer Veränderung des Portfolios explizit zustimmen. Deshalb haften Anlagevermittler in der Regel nicht für die angebotenen Produkte.
Bei Ginmon und Vaamo wird der Algorithmus fast ausschließlich zur Auswahl der Risikoklasse eingesetzt. Ginmon passt das Portfolio noch gelegentlich an die Marktsituation an, Vaamo legt das Geld der Kunden einfach in fünf unterschiedlich gewichteten ETF-Fonds an. Der Grundgedanke heißt: breite Diversifikation. "Wir schichten nicht kurzfristig um, sondern setzen auf langfristige Wertsteigerung", sagt Vaamo-Gründer Oliver Vins. Im Oktober hat er mit der Santander Bank deren Robo-Advisor "Sina" gestartet, der nach demselben Prinzip funktioniert.
Einen dritten Weg – ausschließlich für vermögende Anleger – verfolgt Liqid. Das Berliner Start-up arbeitet mit HQ Trust zusammen, einem Vermögensverwalter für Superreiche, der sich sonst vor allem um das Geld der Unternehmerfamilie Harald Quandt kümmert. Ab 100.000 Euro bekommen Anleger ein gewichtetes und breit gestreutes ETF-Portfolio, bei einem Gebührenaufschlag auch mit weiteren Anlageklassen wie ETFs auf Gold oder Industrierohstoffe. Ab 250.000 Euro können die Kunden auf die Berater des HQ Trust zurückgreifen, die zusätzlich in ausgesuchte, aktiv gemanagte Fonds investieren.
Sicherheit durch einen Partner
Die entscheidende Frage bleibt die nach der Rendite. Die Scalable-Gründer behaupten, ihr Algorithmus habe in der mittleren Risikoklasse eine Rendite zwischen vier und fünf Prozent erwirtschaftet, was nach den Turbulenzen infolge des Brexit durchaus beachtlich wäre. Andere digitale Vermögensverwalter sprechen von ähnlichen Gewinnen. "Es ist aber noch zu früh, um sich ein wirkliches Urteil zu bilden. Wir sind gerade ein Jahr dabei, in der Vermögensverwaltung ist das ein Wimpernschlag" , sagt Scalable-Gründer Podzuweit. Belastbare Aussagen sind bislang kaum möglich.
Kunden sollten sich außerdem darauf einstellen, dass es nicht immer gut läuft. Wer bei den Profilfragen am Anfang angibt, einen jährlichen Verlust von 20 Prozent hinzunehmen, muss das auch wirklich verkraften können. Und dass diese Verlustschwelle sogar überschritten wird, ist ebenfalls möglich.
Im Zweifel können Anleger ihr Vermögen aber kurzfristig abziehen, eine Mindestlaufzeit gibt es bei den meisten Anbietern nicht. Und: Das Geld, das die genannten Roboter verwalten, liegt immer in einem Depot bei einer Partnerbank wie der Deutschen Bank oder der Baader Bank. Dadurch ist es im Falle einer Insolvenz der Unternehmen geschützt. Falls es mit der digitalen Zukunft schneller vorbei sein sollte als gedacht.