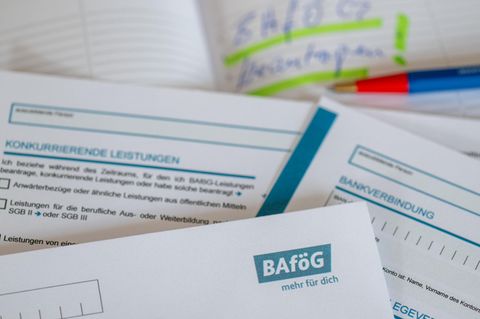Es gibt Menschen, denen sieht man ihren Beruf an, selbst wenn sie ihn schon lange nicht mehr ausüben. Die Art, wie der Mann die Tür zu Zimmer K 335 aufstieß und ohne Zögern auf Burkhard Walter zuging, Anzug, Scheitel, Krawatte, Lächeln: Alles passte. Jede Wette auf Vertreter, dachte Walter. "Ich will mich selbstständig machen", sagte der Mann. Was er denn sei? "Vertreter."
K 335 liegt im dritten Stock des Rathauses von Kassel, hinterer Flügel, Sozialamt. Burkhard Walter ist der Leiter der Abteilung für Existenzgründung. Für viele ist der Beamte die letzte Hoffnung. Auch für jenen arbeitslosen Vertreter Mitte 50, der an einem Freitagvormittag kam, um sein Leben umzukrempeln. Walter griff in seine Schublade und drückte dem Mann 500 Euro "Wochenendkredit" in die Hand, damit er sich mit Ware eindecken konnte: "Ich wollte testen, ob der wirklich ein geborener Verkäufer ist." Am Montag darauf stand der Mann wieder bei Walter: mit 800 Euro. Er hatte auf dem Flohmarkt Kosmetika losgeschlagen.
Ein Wagnis, was sich lohnt
Kassel ist pleite, und viele, die hier leben, sind es auch: Jeder Zehnte der 197.000 Einwohner lebt von der Sozialhilfe. Aus der Not heraus praktiziert die Stadt schon lange, was die Regierung in Berlin mit dem Schlagwort "Ich-AG" populär machen will: Arbeitslose durch schnelle staatliche Förderung in die Selbstständigkeit zu lotsen. Wo keine Bank mehr mitzieht - Amtmann Walter wagt noch etwas. Das Sozialamt geht mit Krediten und Bürgschaften für die neuen Firmen ihrer Klienten ins Risiko - für den Schlüsseldienst eines Iraners, für den türkischen Gemüsehandel, die neue Änderungsschneiderei. Ein Wagnis, das sich lohnt: 368 Menschen, meist mit Familie, arbeiten wieder, statt zu kassieren. Einem arbeitslosen Forstarbeiter verschafft Walter ein Auto, damit der die Sägen transportieren kann. Einem Koch vermittelt er ein Vereinsheim. Niemand im osthessischen Raum hat bei mehr Unternehmensgründungen mitgemischt als der Mann vom Sozialamt. "Wir zeigen, dass diese Leute es noch einmal schaffen können", sagt er, "bei denen geht noch was."
Die Horrormeldungen von der Bundesanstalt für Arbeit - neuester Stand: 4,5 Millionen Arbeitslose - treiben überall im Land immer mehr Jobsuchende dazu, ihre Arbeitskraft als Unternehmer in eigener Sache einzusetzen. Vergangenes Jahr holten sich bundesweit 123.000 Arbeitslose Geld vom Amt, um sich selbstständig zu machen - so viele wie noch nie. Dabei lagen die Hürden ungleich höher als nach den jetzigen Bestimmungen für die Ich-AG. Das weckt kühne Hoffnungen: Von den neuen Ego-Aktiengesellschaften und Minijobs verspricht sich Wirtschaftsminister Wolfgang Clement Hunderttausende Arbeitsplätze. Die Opposition rechnet kaum pessimistischer.
Chefin über sich selbst
Die Politik setzt auf Menschen wie Ingrid Bentrup. Sechs Jahre arbeitete sie hinter der Fleischtheke bei Edeka, wurde mehrmals versetzt - zuletzt in die Obst- und Gemüseabteilung des Supermarktes. Dann verlor die Verkäuferin den Job. Ingrid Bentrup schickte Bewerbungen, jobbte hier und da sogar als Praktikantin. "Ich habe alles versucht", sagt sie über die zwei Jahre Arbeitslosigkeit, die auch ihrer Familie zusetzten. Der Haushalt der Bentrups, zwei Kinder, ist auf Kante genäht, jeder Euro wird dringend gebraucht. "Aber den meisten Firmen, bei denen ich mich beworben habe, war ich schon zu alt." Mit 40.
Heute ist Ingrid Bentrup 42 und eine der ersten Selbstständigen im Sinne des so genannten Hartz-Konzepts. Eine Ich-AG. Was nach Egoismus und Börsengeilheit klingt, schrumpft in der Realität auf Imbissgröße. Seit vier Wochen ist die ehemalige Verkäuferin Chefin über sich selbst und fünf Quadratmeter Unternehmen in der münsterländischen Gemeinde Greven-Reckenfeld. Pommes, Schnitzel, Wurst sind Standard - der hausgemachte Eintopf, den Ingrid Bentrup mittwochs anbietet, macht aus der Bude ihren "Benti’s Snack it". "Ich musste mir was einfallen lassen", sagt sie. "Die Selbstständigkeit war die einzige Chance, wieder Geld zu verdienen."
Wer eine Idee hat, bekommt Cash
Eigentlich wollte Ingrid Bentrup ein Bistro aufmachen mit überbackenen Baguettes. Da fiel ihr in einer Zeitungsannonce der Imbisswagen für 350 Euro Miete im Monat auf. Ohne Abstandszahlung. Das war finanziell leichter zu stemmen als ein Stehrestaurant. Die Würstchenbude steht nun ausgerechnet vor einem Edeka-Markt. Ihr passt diese Nähe zur Vergangenheit: "Mit Fleisch und mit Supermärkten kenn ich mich eben aus." Und ihre erste Existenzkrise hat Ingrid Bentrup auch schon hinter sich. Vor kurzem wurde der Wagen aufgebrochen und die Currywurst-Schneidemaschine gestohlen. Das ist nicht lustig, so ein Ding ist teuer. "Davon lasse ich mich nicht unterkriegen", sagt sie, "heute nicht mehr."
Sprachforschern missfällt die Ich-AG. Sie wählten den Begriff zum Unwort des Jahres 2002. Aber klingt Überbrückungsgeld, das es daneben als Förderung von Jungunternehmern vom Arbeitsamt gibt, so viel besser? Das "Ügeeh", wie Kenner es nennen, federt finanziell die ersten sechs Monate nach der Existenzgründung ab, indem Arbeitslosengeld oder -hilfe weiterlaufen. Doch wer Überbrückungsgeld will, muss dem Arbeitsamt erst einen ausgefeilten Businessplan vorlegen - abgesegnet von der zuständigen Industrie- und Handwerkskammer oder einem Unternehmens- oder Steuerberater. Bei der Ich-AG fallen diese formalen Hürden weg. Wer eine Idee hat, bekommt Cash. Im ersten Jahr gibt es für Existenzgründer 7200 Euro Zuschuss.
Überbrückungsgeld ist für Neugründungen gedacht
Leute wie Ingrid Bentrup besitzen sowieso keine echte Wahl zwischen den Fördertöpfen. Gerade noch 84 Euro im Monat bekam die Imbissbetreiberin zuletzt vom Arbeitsamt überwiesen. Da rechnet sich nur die Ich-AG. Außerdem existierte die Würstchenbude bereits. Das ist zwar gut, um die künftigen Einnahmen zu kalkulieren. Aber mies, wenn man auf Überbrückungsgeld angewiesen ist: Denn bei Geschäftsübernahmen winkten die Damen und Herren vom Arbeitsamt gern ab - Überbrückungsgeld ist für Neugründungen gedacht. Hinter dieser Regelung stecken jahrzehntelange Grabenkämpfe zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Politik. Und die große Frage: Wofür sollen Angestellte mit ihren Versicherungsbeiträgen alles geradestehen? Zumindest Ingrid Bentrup ist die Antwort herzlich egal. Vorher hatte sie keine Arbeit. Jetzt hat sie welche.
Beschäftigung - das zählt für die Gründer, die gestern noch ohne Job dastanden. Das betrifft nicht nur jene, die in den Arbeitsämtern als schwer vermittelbar geführt werden. Der Zusammenbruch der New Economy spülte auch Tausende junge, meist gut ausgebildete Menschen auf den Arbeitsmarkt. Die wagen den riskanten Schritt in die Selbstständigkeit nun besonders häufig.
Eine Ansammlung von Ego-Unternehmen
"Die Idee von einem Job auf Lebenszeit ist passé, den wird es bei uns nie geben", sagt Domenico Galizia. Dass er mal Autos repariert hat, sieht man ihm nicht mehr an. Jetzt ist er Webdesigner. Kurzgeschorene Haare, dunkler Anzug, Laptop. So einer redet nicht lange ohne Flip-Charts und Powerpoint-Präsentation. Bei Agenturen wie Kabel New Media und Popnet leitete Galizia Multimediaprojekte. Die Unternehmen sind Geschichte. Aber das Internet, das gibt es noch. Nachdem er seinen Job los war, gründete Galizia zusammen mit einem Ex-Kollegen in München eine Agentur, die für andere Firmen Internetseiten baut: die Galizia Group.
Das Multimedia-Büro ist eine Ansammlung von Ego-Unternehmern. Galizia und sein Kompagnon Christoph Lemmen schaffen die Aufträge heran. Für die Ausführung trommeln sie dann Teams von Multimedia-Spezialisten zusammen. Die verdienen ihr Geld, solange es etwas zu tun gibt. Wenn Flaute herrscht, ziehen sie wieder ab. "Wir kaufen nur produktive Arbeit ein", sagt Jungunternehmer Lemmen und weiß nicht recht, ob das nun besonders ausgefuchst klingt oder nach purer Ausbeutung. Zumindest scheint das Geschäft zu funktionieren. Galizia und Lemmen rüsten sich schon für die Expansion: Ihre Zwei-Mann-Gruppe haben sie jüngst als Aktiengesellschaft eintragen lassen. So lässt sich später leichter fusionieren - mit Ich-AGs zum Beispiel.
Durch die Pleitewelle sind alle rausgeflogen
Galizia & Co. besitzen gegenüber vielen Not-Gründern einen enormen Bonus: Ihr Selbstvertrauen funktioniert noch blendend. "Dieser Typus sieht seine Kündigung nicht als persönliche Niederlage", sagt Hajo Streitberger, der in Hamburg unter dem Namen Enigma ein Gründerzentrum für Arbeitslose leitet. "Durch die Pleitewelle in deren Branche sind ja alle rausgeflogen." Menschen mit anderen Lebensläufen tun sich da schwerer. "Wenn denen ein Auftrag platzt, interpretieren die das gleich als persönliches Versagen."
Vor drei Jahren noch dachte Streitberger selbst, er habe alles falsch gemacht. Da hockte er in seinem Gründerzentrum im dritten Stock einer ausrangierten Firmenverwaltung in Hamburgs Norden, Old Economy pur, und hielt für seine Klientel allenfalls Träume zweiter Klasse parat, während rundherum Internet-Parvenüs Millionen machten. Heute strahlt nur noch die Reklame der Norddeutschen Klassenlotterie gegenüber in hemmungslosem Wir-machen-Millionäre-Optimismus. Streitbergers Low-Budget-Herberge für Jungunternehmer hingegen boomt. Finanziert vom Arbeitsamt und mit Mitteln der EU probieren hier jeweils 90 Arbeitslose acht Monate lang den Sprung in die Selbstständigkeit. Während der ersten zwölf Wochen läuft die Testphase. Dann muss die Geschäftsidee zünden. In den meisten Fällen gelingt das: Rund 70 Prozent der Firmen, die hier entstanden, überleben das erste Jahr.
Ein Gründerboom sieht anders aus
Eine ähnlich gute Durchhaltequote ihrer Unternehmensgründer präsentiert auch die Nürnberger Bundesanstalt. Keine andere Bildungs- oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zeigt mehr Erfolg. Im Gegenteil - die herkömmliche ABM etwa bringt nicht einmal jeden Dritten zurück in einen festen Job.
Warum Kanzler Gerhard Schröder bei den Bürgern zwar vollmundig mehr Eigeninitiative einfordert, seine Bundesanstalt für Arbeit für die erhoffte Gründerwelle aber kaum mehr Geld ausgeben will, gehört zu den großen Widersprüchen des Konzepts. Die Förderung per Überbrückungsgeld stagniert bei rund einer Milliarde Euro. Für die erfolgversprechende Ich-AG hat Deutschlands oberster Arbeitsvermittler, Florian Gerster, gerade mal 144 Millionen in der Kasse. Das würde für rund 20.000 Ich-Aktionäre in diesem Jahr reichen. Ein Gründerboom sieht anders aus.
Dabei ist die Absicherung vom Amt für die meisten Jungunternehmer überlebenswichtig, Geld ihr Hauptproblem. Die Kreditabteilungen der Banken machen in der Regel gleich die Schotten dicht, oft wird auch der Dispo auf null gesetzt. Ein Dilemma: kein Kredit ohne Bürgschaft, keine Bürgschaft ohne Mietvertrag, kein Mietvertrag ohne Kredit und so weiter.
Kleinkredite sind fast nirgendwo zu bekommen
"Gleichzeitig frisst das Privatleben die Ersparnisse auf", sagt Jochen Rolcke. Er ist 43 Jahre alt, Bauchansatz, Eigentumswohnung, es geht ihm wieder gut. Aber Rolcke raucht heute noch eine halbe Schachtel Zigaretten weg, wenn er von seiner Betteltour durch die Finanzwelt erzählt. Über ein Jahr benötigte der gefeuerte Vertriebsleiter eines Düsseldorfer Papierkonzerns, bis er die Finanzierung seines Hotels in Hamburg durch hatte. Kein Neubau, nichts Großes. Ein Etagenhotel. Nur gepachtet. Alle Geschäftszahlen der ehemaligen Betreiber lagen vor. Doch niemand traute Rolcke so etwas zu. Die eigene Hausbank - lachte nur. Die Bank seiner Eltern - vielleicht, mal sehen. Die Sparkasse - verlangte nach Bürgschaften. Wieder vergingen Monate. Das erste Hotel, das sich Jochen Rolcke ausgesucht hatte, war mittlerweile schon vergeben. Rolcke fing von vorne an, schließlich mit Erfolg.
Das Problem der Finanzierung sieht auch die staatliche Deutsche Ausgleichsbank (DtA). Das Institut hat sich der Förderung von Mittelstand und Existenzgründern verschrieben und musste jüngst feststellen, dass viele seiner hoch dotierten Kreditprogramme für die neuen Unternehmen nicht taugen. Diese Kunden brauchen keine Riesensummen. 82 Prozent der Gründer kommen mit weniger als 25.000 Euro aus, mehr als jeder Zweite benötigt nicht einmal 5.000 Euro. Doch Kleinkredite sind fast nirgendwo zu bekommen. Seit Oktober vergibt die DtA nun auch Mini-Darlehen. Spezielle Fonds legten ähnliche Gründerkredite auf. Anders als bei den EU-Nachbarn fließt das Geld allerdings zäh. Wer durchhalten will, muss die Zähne zusammenbeißen.
Im Stuttgarter Stadtteil Vogelsang wohnt ein Mann, der geht abends ohne einen Cent Gewinn nach Hause, wenn ihm jemand ein paar Zeitschriften klaut. Er heißt Marek Schön, und er hat einen Kiosk an der U-Bahn-Station Bebelstraße übernommen. In dem steht er seit dem 16. März 2002 fast jeden Tag und verkauft Zeitungen und Zigaretten. Die Gewinnspanne ist mickrig. Man muss viel verkaufen, damit es sich lohnt. "Ich mache das hier gern", sagt Schön. "Aber ich weiß nicht, ob ich Ihren Typ Existenzgründer abgebe." Die Geschichte, meint er, solle doch Mut machen.