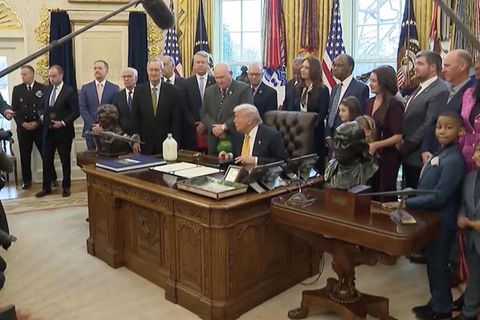Markus Gall ist sauer. Sechs Monate zögerte die Firma das Bewerbungsverfahren des Feinwerktechnikers hinaus - Mitte September kam trotz vorheriger mündlicher Zusage eine Absage des Autozulieferers. Wer dieser Tage in Deutschland Arbeit sucht oder seinen Job behalten will, muss geduldig und flexibel, mobil und möglichst ungebunden sein. Kurzfristige Versetzungen sind keine Seltenheit. Manche Arbeitnehmer halten sich nur mit Hilfe mehrerer Mini-Jobs oder durch Zeitverträge über Wasser.
"Berufliche Mobilitätsanforderungen nehmen immer weiter zu", sagt der Mainzer Soziologe Norbert Schneider, Leiter einer Studie über "Berufsmobilität und Lebensform". Was schon lange für Führungskräfte gelte, habe inzwischen die untersten Ebenen vieler Unternehmen erreicht und erfasse zudem immer mehr Branchen. Etwa jeder sechste Bundesbürger (16 Prozent) im erwerbsfähigen Alter lebe aus beruflichen Gründen beispielsweise in einer Fern- oder Wochenendbeziehung. "Mobilitätserfordernisse gab es immer - man denke an die Welle von Auswanderern nach Amerika Ende des 19. Jahrhunderts - aber in dieser Ausprägung ist das relativ neu", urteilt Schneider mit Blick auf das Zusammenfallen von Konjunkturflaute, hoher Arbeitslosigkeit und Umbau der Sozialsysteme.
Die Arbeitsplatzsicherheit der Vergangenheit ist im Umbruch
Man müsse schon die Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929 bis 1933 heranziehen, um ein vergleichbares Szenario in der deutschen Geschichte zu finden, meint Thomas Kieselbach vom Institut für Psychologie der Arbeit, Arbeitslosigkeit und Gesundheit der Universität Bremen. "Die Arbeitsplatzsicherheit der Vergangenheit ist in vielen Ländern im Umbruch", sagt der Psychologe. "Viele Studienabsolventen etwa müssen bereits drei Jobs annehmen, um ökonomisch überleben zu können." Das werde künftig die Regel sein.
"Man darf die Verantwortung dafür nicht dem Einzelnen alleine aufbürden, sondern muss ihn kompetent beraten und unterstützen", fordert Kieselbach. Zwar sei jeder Erwerbstätige gefordert, sich fortzubilden und seine Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt zu vermarkten. Doch zugleich müssten Firmen ihren Beschäftigten ermöglichen, sich über Anforderungen des Unternehmens hinaus zu qualifizieren. "Künftig sind aktive Sozialpläne gefragt, die nicht nur finanzielle Abfindung bieten, sondern professionelle Hilfen, um bei Entlassung wieder in Beschäftigung zu kommen", sagt Kieselbach.
Berufswege verlaufen heute anders als früher
Im internationalen Vergleich liege Deutschland bei der Entwicklung solcher Modelle relativ weit hinten. Beim Spitzenreiter Niederlande etwa sei die Dichte der Angebote so genannter Outplacement-Beratung 40 Mal so hoch. Ein "Musterbeispiel" in Deutschland ist nach Ansicht Kieselbachs das so genannte Mosaik-Konzept der Deutschen Bank (DB).
Das "DB-Mosaik für Beschäftigung" entstand nach Angaben der Bank 1997/1998. Mitarbeiter können sich dabei mit Hilfe verschiedener Bausteine permanent für den internen oder externen Arbeitsmarkt fortbilden. "Angesichts des tief greifenden Wandels in Wirtschaft und Arbeitswelt kann kein Unternehmen heute mehr seinen Mitarbeitern die dauerhafte Beschäftigung in einem bestimmten Bereich garantieren", begründet der Leiter des DB-Ressorts Personal/Beschäftigungsmodelle, Ralf Brümmer, die Initiative. "Berufswege verlaufen heute anders als früher, wo Menschen oft von der Lehre bis zur Rente in einem Unternehmen oder sogar in einer Abteilung blieben."
"Vom Opfer zum Gestalter"
90 Prozent der Beschäftigten, bei denen eine berufliche Neuorientierung anstehe, nutzen laut Brümmer die Qualifizierungsangebote. Das so genannte JobCenter sowie das JobCoaching etwa hätten in vergangenen zwei Jahren 2.000 Mitarbeiter wahrgenommen. Von Mitarbeitern werde heute zwar mehr Mobilität und Flexibilität gefordert, sagt Brümmer. Doch durch Coaching und Orientierungshilfe würden sie "vom Opfer zum Gestalter".
Markus Gall, dessen alter Firma die Pleite drohte, fühlt sich als Opfer der derzeitigen Lage auf dem Arbeitsmarkt. Der Autozulieferer, bei dem er sich beworben hatte, habe "mündliche Zusagen gemacht und diese nicht eingehalten". Erst nach etlichen Gesprächen und Telefonaten hatte er Gewissheit - und die Absage im Briefkasten. "Ich war dazu gezwungen, das mitzumachen, es sah so aus, als würde ich in die Arbeitslosigkeit abrutschen", sagt der 34-Jährige und räumt zugleich ein: "In der momentan schwierigen wirtschaftlichen Lage macht man deutlich mehr mit." Gall hat Glück gehabt. Seine alte Firma entging der Pleite und er konnte bleiben - zunächst zumindest.
Jörn Bender, dpa