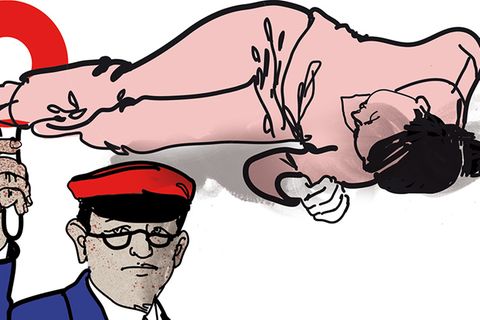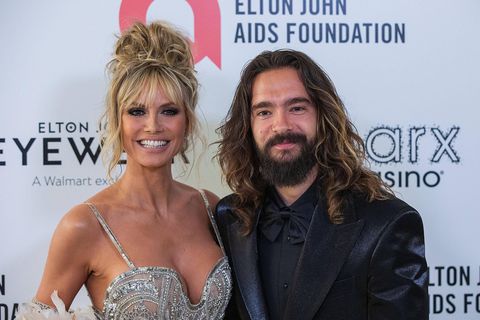Wenn von Corona-Leugner*innen, Esoteriker*innen und Verschwörungstheoretiker*innen die Rede ist, mischt sich oft der Begriff des Heilpraktikers in die aufgeregten Debatten. Für viele Kritiker*innen sind die Naturheilverfahren Quacksalberei, die jeder Wissenschaftlichkeit entbehren und nur allzu gut in die Schubladen passen, die die Corona-Debatte aufstößt. Der Berufsstand hat ein Imageproblem, das sich im vergangenen Jahr verschärfte.
Das weiß auch Elena Mattuschka, die als ausgebildete Heilpraktikerin angehende Kolleg*innen auf die Prüfung vorbereitet. "Ich möchte den Heilpraktiker-Beruf aus der Eso-Ecke holen", sagt sie im Gespräch. Man weiß sofort, was sie meint. Heilpraktiker*innen, das sind die Menschen, die Ende 40 nochmal denken, sie müssten ihr Leben umkrempeln – so etwa das gängige Bild? Ja, sagt Elena, und erzählt von all den jungen Heilpraktiker*innen, die das Gegenteil beweisen.
Wer sich mit der Kritik an dem Berufsstand beschäftigt, merkt schnell, dass die verschiedensten Informationen über Ausbildung und Berufsleben von Heilpraktiker*innen das Internet fluten. Im Gespräch erzählt Elena, wie die Ausbildung wirklich abläuft, wo die Grenzen für Heilpraktiker*innen liegen und warum ihr Beruf auf so viel Kritik stößt.
Elena, was machen Heilpraktiker*innen eigentlich?
Heilpraktiker*innen therapieren Patient*innen in Naturheilverfahren. Die Bezeichnung Heilpraktiker*in bedeutet erstmal, dass der- oder diejenige die Prüfung durch das Gesundheitsamt bestanden hat. Es sagt aber noch nichts darüber aus, welches Naturheilverfahren angewendet wird. Ganz bekannte Naturheilverfahren sind zum Beispiel Osteopathie, Akupunktur und Homöopathie – aber es gibt sehr viele verschiedene. In dem jeweiligen Naturheilverfahren bilden sich die Heilpraktiker*innen nach oder bereits während ihrer Ausbildung weiter. Also jeder und jede Osteopath*in ist immer auch Heilpraktiker*in, weil kein Naturheilverfahren ausgeübt werden darf, ohne die Heilpraktikerprüfung abzulegen.
Wie läuft die Ausbildung ab?
Es gibt keine staatlich geregelte Ausbildung für den Beruf – das ist etwas, das auch immer wieder kritisiert wird. Man kann seine Heilpraktikerausbildung an einer Präsenzschule machen mit täglichem Unterricht oder im Fernstudium, beides dauert etwa drei Jahre. Während der Ausbildung wird die komplette Schulmedizin gelernt, das heißt die Pathologie und Physiologie der Organe und sämtliche Module wie Orthopädie, Urologie, Herz-Kreislauf-System, Niere, Gynäkologie, Onkologie und so weiter. Alles, was die Medizin hergibt. Viele denken, sie könnten den Heilpraktiker nebenbei machen und merken dann schnell, dass die Ausbildung sehr herausfordernd und lernintensiv ist.
Zur Person
Elena Mattuschka ist 27 Jahre alt und lebt in Berlin. Nach ihrem Abitur studierte sie Psychologie, merkte aber schnell, dass sie den Menschen ganzheitlicher betrachten möchte. Körper und Geist gehören für Elena zusammen. Also ließ sie den Masterabschluss sausen, hörte nach dem Bachelor auf und bildete sich als Heilpraktikerin aus. Heute ist Elena auf Cranio Sacral Therapie (entwickelt aus der Osteopathie) und Frauenheilkunde spezialisiert. Auf ihrem Instagramkanal "Natürlich Elli" informiert sie zu Ausbildung und Prüfung von Heilpraktiker*innen und bereitet Prüflinge mit Intensivkursen nach ihrer Ausbildung auf den Abschluss vor. Ihr Podcast "Medizin im Ohr" richtet sich an Heilpraktikeranwärter*innen, Pflegefachkräfte und alle Menschen, die sich für Medizin und Gesundheit interessieren.
Drei Jahre sind im Vergleich zu einem Medizinstudium jedoch recht wenig. Warum ist die Heilpraktikerausbildung deutlich kürzer?
Wir dürfen ja nicht das, was Medizinerinnen und Mediziner dürfen – und das ist auch gut so. Ich würde den Einwand verstehen, wenn Heilpraktiker*innen die gleichen Rechte hätten wie Mediziner*innen, aber das haben wir nicht. Wir wenden andere Therapien an, haben Gesetze und Sorgfaltspflichten und dürfen viele Krankheiten gar nicht behandeln. Außerdem ist es ein Irrtum, dass die Ausbildung von Heilpraktiker*innen nach drei Jahren endet. Nach der Heilpraktikerprüfung bilden sich die Absolvent*innen im jeweiligen Naturheilverfahren weiter, was bei der Kritik nicht berücksichtigt wird. Bei der Osteopathie zum Beispiel sind das nochmal vier bis fünf Jahre, bei der traditionellen chinesischen Medizin, zu der auch Akupunktur gehört, genauso. Dann kommt man schnell auf die Dauer eines klassischen Medizinstudiums.
Und am Ende der Ausbildung steht die Prüfung durch das Gesundheitsamt?
Genau. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ausbildungen, bei denen es mindestens eine Zwischenprüfung gibt, werden angehende Heilpraktiker*innen nur am Ende ihrer Ausbildung geprüft. Zuerst durch einen schriftlichen Teil und wer den besteht, wird zu einer mündlichen Prüfung durch Amtsärzte eingeladen. Beides setzt viele Prüflinge extrem unter Druck, weil das gesamte Wissen aus drei Jahren Ausbildung an zwei Tagen abgefragt wird und dementsprechend parat sein muss. Deshalb gilt die Heilpraktikerprüfung als sehr anspruchsvoll und es gibt hohe Durchfallquoten. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich eine gute Schule zu suchen. Es gibt Schulen, die in zehn Monaten auf die Prüfung vorbereiten wollen – aber das funktioniert nur mit sehr viel Vorwissen und sollte nicht das Ziel sein. Es ist immer besser, seine Ausbildung mit Ruhe und Zeit zu absolvieren, um später erfolgreich zu behandeln.
Wie hoch ist die Durchfallquote bei der Prüfung?
Das kommt sehr aufs Bundesland an. Es bestehen so zwischen 20 und 50 Prozent der Prüflinge. Wenn nur 50 Prozent durchfallen, ist das schon richtig gut.
Würdest du dir wünschen, dass die Ausbildung staatlich geregelt wird – vielleicht auch, weil die Prüflinge dann besser vorbereitet würden?
Das wird immer wieder in unserer Community diskutiert. Die meisten sind dafür, weil es den Druck von der Prüfung nehmen würde, wenn es zum Beispiel Zwischenprüfungen gäbe. Dann wäre auch die Chance zu bestehen in jedem Bundesland gleich groß. Derzeit prüft jedes Gesundheitsamt unterschiedlich, zwar mit den gleichen Inhalten, aber die Amtsärzte bestimmen in den mündlichen Prüfungen selbst, was sie abfragen. Ich persönlich hätte mir eine staatlich geregelte Ausbildung gewünscht, weil ich wirklich überfordert war am Anfang. Es gibt auch viele Heilpraktikerschulen, die eine staatliche Anpassung der Ausbildung klar befürworten. Das Bundesministerium prüft schon seit 2019, ob und wie die Ausbildung angepasst werden soll – ich bin gespannt, was dabei herauskommt.
Du hattest schon erwähnt, dass es Krankheiten gibt, die Heilpraktiker*innen nicht behandeln dürfen. Welche sind das?
Krebs ist zum Beispiel eine Krankheit, die ich aufgrund meiner Sorgfaltspflicht nicht behandeln dürfte. Hier ist die Schulmedizin ganz weit vorne und hat ihre Berechtigung in jeglicher Weise. Genauso ist es mit Infektionskrankheiten wie aktuell Corona. Es gibt rund 70 Erreger, die Heilpraktiker*innen nicht behandeln dürfen. Allerdings gibt es einige Krankheiten, bei denen eine begleitende Therapie zur Schulmedizin möglich ist.
Schulmedizin und Naturheilverfahren können sich also ergänzen?
Ja, und das sollten sie noch viel mehr! Bei den allermeisten Heilpraktiker*innen wird während der Erstanamnese nach den letzten Voruntersuchungen beim Hausarzt oder der Hausärztin gefragt. Wenn die schon lange zurückliegen, sollte man sich sich vor dem nächsten Termin einmal durchchecken lassen. Dinge wie Ultraschall, Röntgen oder Operationen fallen eben nicht ins Aufgabengebiet von Heilpraktiker*innen.
Was sind die Hauptbeweggründe, warum Menschen zu Heilpraktiker*innen gehen? Wann kommen die Patient*innen zu euch?
Viele kommen, wenn sie schulmedizinisch austherapiert sind. Das hat man oft bei Schmerzpatient*innen, die sämtliche Medikamente genommen haben, operiert wurden und bei denen die Ärztinnen und Ärzte irgendwann nicht mehr helfen können. Bei mir war es nicht anders: Ich hatte chronische Kopfschmerzen, aber organisch war alles in Ordnung. Da fragt man sich natürlich: "Muss ich jetzt damit leben oder probiere ich mal einen ganz anderen Weg aus?" Diese Überlegung treibt viele zu Heilpraktiker*innen. Und dann gibt es natürlich auch die Patient*innen, die sich in der Naturheilkunde generell besser verstanden fühlen als in der Schulmedizin oder sie einfach spannend finden.
Nach einer Umfrage zweier Heilpraktikerverbände aus dem Jahr 2017 sind fast zwei Drittel der Patient*innen Frauen. Warum fällt Männern der Gang zu Heilpraktiker*innen so schwer?
Ich glaube Männern fällt es oft schwerer, sich Hilfe zu suchen und diese anzunehmen. Meiner Erfahrung nach neigen Männer dazu, erstmal abzuwarten, vielleicht lieber eine Schmerztablette zu nehmen und den Alltag inklusive Arbeit weiterzuleben. Aber auch das verändert sich in den letzten Jahren, die Zahl der männlichen Patienten wächst stetig.
Wie alt sind die Heilpraktikeranwärter*innen im Durchschnitt, die du auf ihre Prüfungen vorbereitest?
Der Beruf verjüngt sich total, das ist eine schöne Entwicklung. Die meisten Prüflinge aus meiner Community sind zwischen 24 und 32 Jahren alt. Es ist häufig der zweite Bildungsweg und bei manchen sogar schon der erste.
Stimmt es, dass man erst ab dem 25. Lebensjahr als Heilpraktiker*in arbeiten darf?
Ja, man kann die Prüfung erst mit 25 Jahren ablegen. Das ist ein sehr altes Gesetz, das nie angepasst wurde. Da die Ausbildung allerdings ein paar Jahre dauert, kann man natürlich schon deutlich früher Heilpraktikeranwärt*in sein. Ich habe mit 21 Jahren angefangen, mich in Naturheilkunde auszubilden, und mit 26 die Heilpraktikerprüfung abgelegt.
Mit 27 Jahren bist du ja auch noch sehr jung. Ich würde davon ausgehen, dass man als Heilpraktikerin viel Feingefühl und Lebenserfahrung braucht. Ist es da sinnvoll, schon so früh in dem Beruf zu arbeiten?
Jemand, der 25 ist muss nicht unbedingt weniger Lebenserfahrung haben als jemand, der 32 ist. Es kommt immer darauf an, welche Erfahrungen hinter einem liegen und was man vor der Ausbildung gemacht hat. Es gibt viele angehende Heilpraktiker*innen, die aus medizinischen Berufen kommen, wie Krankenpfleger*innen, Physiotherapeut*innen und Psycholog*innen. Da ist die Anamnese schon ins Blut übergegangen, bevor sie mit der Ausbildung anfangen.
Was haben deine Eltern gesagt, als du nach deinem Psychologiestudium lieber Heilpraktikerin werden wolltest?
Meine Eltern waren nicht so begeistert. Da kamen Fragen wie: "Was ist das denn überhaupt?" und "Bist du dir wirklich sicher?" Aber ich wollte das machen, was mir Spaß macht und wo ich mich später sehe. Nach den ersten Unsicherheiten haben sie mich dann auch unterstützt.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch Angst hatten, du würdest als Heilpraktikerin schlecht um die Runden kommen. Was verdient man denn in deinem Beruf?
Es ist schwierig, genaue Angaben zum Gehalt zu machen, weil man als Heilpraktiker*in freiberuflich arbeitet und selbstständig ist. Wenn man seine eigene Praxis hat, kommt es darauf an, wie gut man ausgebildet wurde, ob man weiterempfohlen wird, wie viele Patient*innen man hat und so weiter – das sind viele Faktoren. Die wenigsten Verfahren werden über die Kassen abgerechnet, deshalb bestimmen Heilpraktiker*innen ihre Preise selbst. Es gibt zwar eine Gebührenverordnung, aber die ist seit Jahrzehnten nicht angepasst worden und dient nur der Orientierung. Gebunden ist man daran nicht. Ich denke, dass die meisten Heilpraktiker*innen 2500 bis 5000 Euro brutto verdienen – nach oben offen.
Ist der Start in die Selbstständigkeit schwierig für Heilpraktiker*innen nach bestandener Prüfung?
Man sagt ja oft, es brauche fünf Jahre in der Selbstständigkeit, bis man davon leben kann. Die meisten Heilpraktiker*innen, die ich kenne, haben allerdings schon im zweiten Jahr nach der Prüfung gut von ihrem Beruf leben können. Gerade wenn man für die Kundenakquise auch Social Media nutzt, kommen die ersten Patient*innen meist recht schnell.
Wenn man zu Heilpraktiker*innen recherchiert, stößt man immer wieder auf Medienberichte und allerlei Meinungsäußerungen, die den Beruf stark kritisieren oder gar für gefährlich halten. Woran liegt das?
Es gibt viele, die kritisieren, aber sich nicht richtig informieren. Immer wieder wird geschrieben, dass man nur einen Hauptschulabschluss braucht und 25 Jahre alt sein muss, um sich Heilpraktiker*in zu nennen – was natürlich Unsinn ist. Die Medien spielen auch eine wesentliche Rolle bei dem Image des Berufes. Wenn Dokus über Heilpraktiker*innen gezeigt werden, sieht man immer die schwarzen Schafe, die es in jeder Branche gibt – nie solche Heilpraktiker*innen, die seit vielen Jahren erfolgreich arbeiten. Dabei gibt es immer wieder Statistiken darüber, wie wenig Behandlungsfehler Heilpraktiker*innen machen im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen (Anm. der Red.: Zuletzt veröffentlichte der Berufs- und Fachverband Freie Heilpraktiker e.V. ein entsprechendes Gutachten). In den Medien wird trotzdem nur der Fall thematisiert, in dem zum Beispiel eine Krebspatientin von einem Heilpraktiker behandelt wurde – was unglaublich fahrlässig ist und gegen unsere Sorgfaltspflicht geht. Ich kenne persönlich niemanden in diesem Beruf, der oder die das tun würde.
Belasten dich die negativen Kommentare zu deinem Beruf?
Es beschäftigt mich schon, dass ich als Heilpraktikerin von anderen immer wieder einen Dämpfer bekomme. Das sehe ich auch bei den Auszubildenden, die sich häufig gar nicht trauen, in ihrem Umfeld von ihrer Ausbildung zu erzählen. Die erzählen oft gar nichts oder sagen sie würden eine Yoga-Ausbildung oder so etwas machen, weil sie Angst haben, anders behandelt zu werden.
Gibt es etwas, womit du ihnen dann Mut machst?
Wir können halt nichts ändern, wenn wir uns nicht zeigen. Wenn man Angst hat, zu sagen, was man tut, ist es nicht nur für einen selbst belastend, es vertieft diese Missstände und die Vorurteile auch noch. Diese ganzen jungen, super ausgebildeten Heilpraktiker*innen sollten sich zeigen, nur so können wir was verändern.
Quellen: Umfrage zur Geschlechterverteilung unter Patient*innen der Heilpraktikerverbände VUH und VFP, Statistisches Gutachten zur Untersuchung von Behandlungsfehlern im Auftrag des Berufs- und Fachverbandes Freie Heilpraktiker e.V.
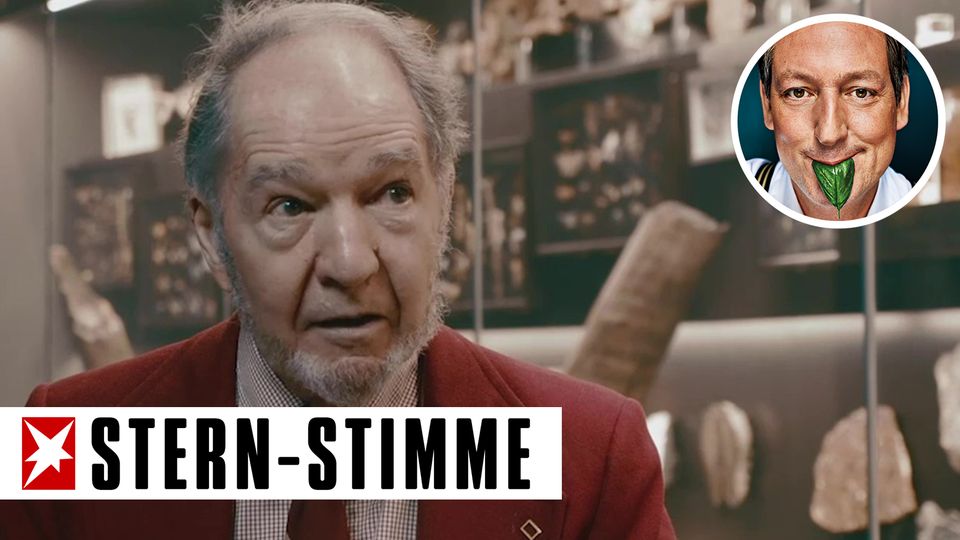
Sehen Sie im Video: Jared Diamond ist ein Experte auf vielen Gebieten. Er hat über Evolutionsbiologie, Geographie, die Gallenblase und über Krisen geschrieben. Im Gespräch mit Eckart von Hirschhausen geht es um nicht weniger als unser eigenes Fortbestehen.