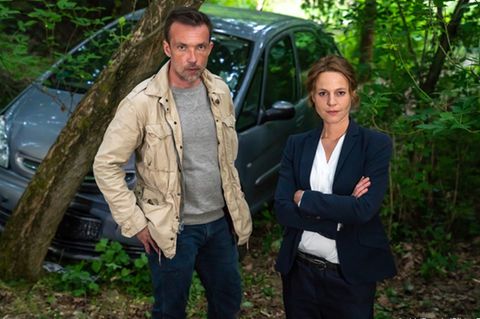Zwölf Jahre werden Atomkraftwerke im Schnitt länger laufen als bisher geplant. Vermutlich aber bleiben sie länger am Netz. Denn die Laufzeit ergibt sich aus der noch zu produzierenden Strommenge - und die lässt sich manipulieren.
Die Bundesregierung hat mit ihrem Atomkompromiss die Laufzeiten der Atomkraftwerke weit über den Zeitraum hinaus verlängert, den Rot-Grün 2001 vereinbart hatte. Durchschnittlich werden die AKW zwölf Jahre länger am Netz bleiben - die älteren, bis 1980 ans Netz gegangenen Anlagen, acht Jahre, die Jüngeren 14 Jahre. Dadurch erhöht sich die Gesamtlaufzeit von 32 auf 40 bis 46 Jahre. Das könnte - je nach Produktion der Anlagen und Strommengenübertrag von stillgelegten Meilern - Atomkraft in Deutschland bis 2040 oder sogar 2050 bedeuten.
Zeitlich genau festlegen lässt sich das Aus für einzelne Atomkraftwerke nicht.
Im Einzelnen heißt das:
- Das Abschaltjahr wird von zwei Größen beeinflusst: Welche Reststrommenge insgesamt einem Kraftwerk zugestanden wird, und in welchem Tempo ein Kraftwerk diese Menge produziert.
- Entscheidend ist, welche Jahres-Leistung der Kraftwerke zugrundegelegt wird. Beim Atomausstieg wurde angenommen, dass die Atommeiler etwa 95 Prozent ihrer möglichen Leistung auch tatsächlich ins Netz einspeisen - das wäre ein Stromjahr. Nun soll diese Rechengröße schrittweise von 95 Prozent auf 85 Prozent verringert werden - was im Ergebnis zu einer geringeren Reststrommenge führt.
- Die Auslastung kann zudem jeder Betreiber individuell steuern, indem er die Leistung rauf- oder runterfährt. Auch vorübergehende Stilllegungen - etwa durch Pannen oder für Wartungsarbeiten - verlängern die kalendarische Laufzeit: So hat dieses Modell dazu geführt, dass das Atomkraftwerk Brunsbüttel, das schon längst hätte vom Netz gehen sollen, weiterhin in Betrieb ist. Grund: Es produziert wegen einer Pannenserie seit zweieinhalb Jahren keinen Strom mehr, die Wiederinbetriebnahme ist für 2011 geplant.
- Selbst der Ausbau von regenerativen Energien kann zur Folge haben, dass die AKW länger am Netz bleiben. Die paradoxe Situation tritt ein, weil zunächst der Strom aus alternativer Erzeugung ins Netz eingespeist wird und der "Rest" aus den Kernkraftwerken kommt. Je mehr Energie aus Windkraft- oder Solaranlagen stammt, desto weniger müssen die Meiler zuliefern, was wiederum deren Laufzeit verlängert.