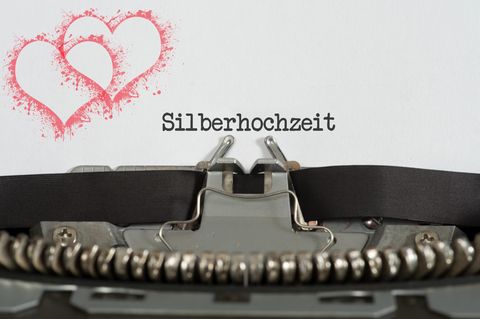Wie gut die Geschäfte laufen, erkennt Günter Lohmann am Geruch: je strenger, desto besser. Heute mieft es kaum. Nur ein paar Stöße Hausabfälle verlieren sich in der Anlieferungshalle der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (WEV). Ein Müllwagen kippt eine Ladung Unrat auf den blanken Betonboden. Geschäftsführer Lohmann lächelt, fast ein wenig dankbar. Er braucht jede Tonne, um den Betrieb profitabel zu führen.
Hier in Großpösna bei Leipzig betreibt die WEV die Deponie Cröbern und eine Abfallbehandlungsanlage. Der Siedlungsmüll, den Lkws ankarren, wird klein gehackt und maschinell in Schrott, Ersatzbrennstoff (Joghurtbecher, Windeln) und organische Stoffe sortiert. Die Metalle lassen sich verkaufen, der Ersatzbrennstoff wird in Müllverbrennungsanlagen (MVA) oder Industrieöfen verfeuert. Die organischen Stoffe landen nach einem Verrottungsprozess auf der Deponie. Alles ökologisch, aber nicht ökonomisch: Denn der Betrieb ist hoffnungslos überdimensioniert. Die Deponie benötigt 600.000 Tonnen Abfall pro Jahr, um Plus zu machen. Leipzig und die angeschlossenen Landkreise liefern gerade mal die Hälfte.
Müll ist Money, also muss Lohmann die fehlende Tonnage anderswo auftreiben. Und das wird schwieriger. Sind irgendwo im Land ein paar Ladungen zu haben, stürzen sich gleich Wettbewerber und professionelle Müllmakler darauf. Deshalb muss Lohmann auch im Ausland akquirieren. Mit Erfolg, wie der Drecksberg in der linken Ecke der Anlieferungshalle zeigt: Abfall aus Neapel, das im Zivilisationsschutt erstickt. Mehr als 62.000 Tonnen hat die WEV seit Mai 2007 von dort importiert. Das sicherte den Betrieb. Vier bis fünf "Züge der Schande", wie Italiens Noch-Ministerpräsident Romano Prodi die Transporte nannte, laufen jede Woche auf den Gleisen neben der WEV-Verwaltung ein.
In ganz Deutschland wird der Abfall knapp
Ist es nicht Irrsinn, Müll über 1600 Kilometer heranzukarren? "Ja", sagt Privatmann Lohmann spontan. "Nein", schiebt der Müll-Manager Lohmann eilig nach: "Wir brauchen den europäischen Markt dringend." Denn die WEV ist kein gemütlicher Kommunalbetrieb ohne Gewinnerwartung: 49 Prozent gehören der Sita, einer Tochter des renditehungrigen französischen Mischkonzerns Suez Environnement.
Großpösna ist überall: In ganz Deutschland wird der Abfall knapp. Landauf, landauf landab raufen sich Betreiber von Müllverbrennungsanlagen, Müllkraftwerken und Deponien um den Kehricht. Ludger Rethmann, Vorstandschef von Marktführer Remondis, sagt: "Wir sprechen nicht mehr darüber, ob, sondern nur noch wie viele Überkapazitäten wir haben werden." Einige seiner 16 Verbrennungsanlagen laufen bereits auf Sparflamme. Laut dem Marktforschungsinstitut Prognos wird im Jahr 2015 der Abfall nur noch für 60 Prozent der Öfen reichen. Grund: Konzerne wie der Energieriese Steag, aber auch Continental oder Hoechst ziehen eigene Müllkraftwerke hoch, um billiger an Strom, Wärme und Dampf zu gelangen. Laut Michael Braungart, Professor für Verfahrenstechnik an der Universität Lüneburg, sind derzeit 70 solcher Ersatzbrennstoffanlagen in Planung oder im Bau - mit Heißhunger auf elf Millionen Tonnen Abfall pro Jahr.

Es geht ums Geld – der Finanz-Newsletter
Ob Bausparvertrag oder Bitcoin – machen Sie mehr aus Ihrem Geld: Der stern weist Ihnen in diesem Newsletter den Weg durch den Finanz-Dschungel, kompakt und leicht verständlich, mit konkreten Tipps für den Alltag. Immer freitags in Ihrem Postfach. Hier geht es zur Registrierung.
In den vergangenen Jahren herrschte Goldgräberstimmung am Markt. Denn gleichgültig, wie hoch die Entsorgungskosten für Hausabfälle auch ausfallen - die Bürger zahlen die Zeche. Entweder über die Abfallgebühren der Kommunen oder, bei Leichtverpackungen und Elektroschrott, über die im Ladenpreis versteckte Entsorgungsabgabe. Die Gewinne sacken die Sammler und Verwerter ein, allen voran die Müllriesen Remondis, Veolia, Alba, Sita und Tönsmeier. In Deutschland beschäftigt die Branche 250.000 Leute und macht einen Umsatz von über 50 Milliarden Euro - mehr als der Automobilkonzern BMW. "Abfallwirtschaft gleich Umweltschutz" lautet die Botschaft der Müllentsorger an die Millionen Verbraucher. Mit gutem Gewissen wegwerfen.
Die Botschaft wirkt: Die Deutschen produzieren mit fast 600 Kilo pro Kopf und Jahr noch genauso viel privaten Unrat wie in den 90er Jahren. Bei Papier und Verpackungen wächst der Müllberg sogar wieder. Selbst messianische Umweltschützer schleppen ohne Gewissensbisse folienverschweißte Kunststoff-Sixpacks oder Wurst im Plastepack aus dem Aldi. Und in den Drogerien finden sich wieder reihenweise Cremes und Pasten in Umverpackungen, die lange tabu waren. Die wenigsten Verbraucher wissen, dass rund drei Viertel des Siedlungsmülls verbrannt werden. Dass ein Joghurtbecher auch dann als "verwertet" gilt, wenn er in einer stromerzeugenden MVA endet.
Müll wird inzwischen nicht mehr nur wegen seines Brennwerts, sondern auch wegen der darin enthaltenen Wertstoffe zum Geschäft. Sogar Glas, Papier, Metall und minderwertiges Mischplastik lassen sich verkaufen. Selbst für Ersatzbrennstoffe, also etwa die geschredderten Joghurtbecher und Pampers aus Großpösna, werden die Müllverbrenner bald zahlen, weil auf ihnen keine Mineralölsteuer liegt und sie billiger werden als Heizöl.
Müll ist gefragt
Die Wertstoffe sind so gefragt, dass sich einige Gemeinden gegen Privatentsorger wehren müssen, die blaue Tonnen aufstellen, obwohl die Papierhoheit gesetzlich bei den Kommunen liegt. Und in Wohnanlagen picken private Sammeltrupps Dosen, Flaschen, Eisen und andere lukrative Wertstoffe aus den Sammelabfallcontainern, bevor die Müllautos sie abholen.
Wie das Müllgeschäft in Zukunft funktioniert, ist bei Marktführer Remondis (2,3 Milliarden Euro Umsatz) im Lippewerk Lünen schon heute zu sehen: Auf dem 230 Hektar großen Gelände rattert, klopft und scheppert es allerorten. Norbert Rethmann, der legendäre Firmenpatriarch, der die halbe Branche zusammenkaufte, muss den Lärm als klingende Münze vernehmen, so erfreulich entwickelt sich sein Geschäft. 1,6 Millionen Tonnen Abfall werden hier pro Jahr aufbereitet, darunter Kunststoff, Biomüll, Holz und Schlacke.
Gleich neben der Hauptverwaltung steht das Rückbauzentrum Elektrorecycling, wo alles verwertet wird, was einen Stecker hat. Seit 2006 dürfen Elektrogeräte nicht mehr in die graue Tonne. Vor der Halle sieht es aus, als hätte eine Planierraupe einen Media Markt zusammengeschoben: Radios, Staubsauger, Rasenmäher und andere Haushaltsgeräte türmen sich meterhoch. Ein Bagger greift in den Haufen und legt die Ware auf ein Förderband. Von dort aus gelangt sie zu einer Hightech-Bearbeitungsanlage. Kaum fünf Minuten später spuckt die Maschine die Apparate wieder aus: fein zerschreddert und nach Fraktionen getrennt. Kunststoffe, Eisen, Metalle wie Aluminium und Messing sowie Platinenteilchen landen in verschiedenen Containern. Eisen zum Beispiel, das mit einem Magneten extrahiert wurde, bringt Remondis rund 200 Euro pro Tonne. Früher musste man Schrotthändlern Geld dafür geben, dass sie das Zeug vom Hof holten. Dabei sind Platinen oder Computerstecker wahre Preziosen, weil sie Gold, Silber und Palladium enthalten. Satte 30 Prozent Marktanteil halten die Westfalen beim Elektroschrott. Beim Remondis-Tochterunternehmen Ecomotion wird aus fetthaltigen Essensresten und Schlachtabfällen Biodiesel hergestellt. Besonders ergiebig ist das Frittenfett von McDonald's oder Burger King. 70 Millionen Liter pro Jahr produziert die Anlage.
Über 3000 Fahrzeuge der Remondis-Flotte, darunter die Müllfahrzeuge, laufen mit Sprit aus eigenem Haus - für günstige 97,5 Cent der Liter.
Klingt gut - doch in den meisten anderen Fällen hat das Geschäft mit dem Abfall viele Haken: Wenn aus Müll Geld werden soll, ist oft die Umwelt der Verlierer. Die Entsorger versuchen herauszuquetschen, was geht. So lässt manch halbseidener Müllkutscher die Tonne lieber für 20 bis 30 Euro als Füllmaterial in einer alten Kiesoder Tongrube verschwinden, als sie zu einer Müllverbrennungsanlage zu fahren, wo sie 150 Euro kostet. Der jüngste Vorfall in der Tongrube Vehlitz (Sachsen-Anhalt), wo offenbar über Wochen Hausmüll verscharrt wurde, ist nur einer von vielen, verstreut über die ganze Republik. Bei den Staatsanwaltschaften, allen voran Brandenburg, stapeln sich die Fälle illegaler Entsorgung. Nach Remondis-Schätzungen gehen dem Markt so mehrere Millionen Tonnen Brennstoff verloren.
"Wir werden zur Müllnation der Welt"
Professor Braungart hält vor allem den Import von Abfall zur Verbrennung für ökologisch fatal; schon jetzt werden acht Millionen Tonnen des noch gefährlicheren Importsondermülls in Deutschland verfeuert. "Wir werden zur Müllnation der Welt", warnt der Wissenschaftler. Nach seinen Erkenntnissen sind Kraftwerke für Ersatzbrennstoffe "Feinstaub-, Quecksilberund Dioxinschleudern". Selbst über die Hälfte der als sauber gepriesenen Müllverbrennungsanlagen halten laut Braungart die Quecksilbergrenzwerte nicht ein. Die Gesundheit der Bevölkerung werde massiv geschädigt. utoimmunerkrankungen würden zur Volksseuche.
Ungeachtet dessen macht die Wirtschaft mächtig Druck in Brüssel: Abfall soll Handelsgut ohne behördliche Genehmigung werden - wie Herrensocken.
Langsam aber wächst in der Bevölkerung der Widerstand. Am heftigsten tobt der Kampf gegen die Dreckschleudern derzeit im sächsischen Ort Leppersdorf in der Nähe von Dresden. Hier will ein für seine Ruppigkeit bekannter Unternehmer ein Müllkraftwerk für 300.000 Tonnen pro Jahr hochziehen: Theo Müller, Eigner der Müller-Milch-Gruppe. Die Anlage soll preiswerte Energie für seine örtliche Molkerei erzeugen. Seit zwei Jahren wehrt sich die Bevölkerung mit Bürgerentscheiden gegen die Baugenehmigung. Dennoch scheint Müller, bestens vernetzt im Rat der zuständigen Gemeinde Wachau, zu obsiegen. Die Interessengemeinschaft "Gesunde Zukunft - keine Müllverbrennung bei Müllermilch" fürchtet nun unberechenbare Folgeschäden. "Im heutigen Siedlungsabfall ist ein Schadstoffcocktail von über 60.000 verschiedenartigen chemischen Verbindungen enthalten", warnen die Greenpeace-Umweltschützer. "Diese zum größten Teil in den Konsumprodukten fest eingebundenen Chemikalien werden erst über die Verbrennung des Abfalls frei."
Gesundheitsschäden
Greenpeace stützt den Kurs der Widerständler. Schon vor sieben Jahren schlugen Wissenschaftler der Organisation in der Untersuchung "Müllverbrennung und Gesundheit", erstellt vom Greenpeace-Forschungslabor der britischen Universität Exeter, Alarm wegen der unabsehbaren Folgen der Technik: Personen, die bei Müllverbrennungsanlagen beschäftigt seien und in der Nähe lebten, zeigten eine "breite Palette von Gesundheitsschäden, die mit MVA-Emissionen in Zusammenhang stehen. Die Studien geben Anlass zu größter Sorge". Die Forscher fanden Gift im Urin, ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko und Atemwegserkrankungen. Noch heute, heißt es bei Greenpeace, "ist es unmöglich, vorherzusagen, welche gesundheitlichen Schäden durch MVAs auftreten können, egal, ob es sich um alte oder umwelttechnisch verbesserte Anlagen handelt".
Den Verbrauchern droht auf einem weiteren Feld eine Niederlage: Kritiker argwöhnen, dass sich am Ende der kannibalisierenden Hatz auf den Unrat ein Oligopol bilden wird wie im Strommarkt. Die Großen fressen die Kleinen - und teilen den Markt dann diskret unter sich auf. Joachim Wuttke, Fachmann beim Umweltbundesamt, kennt das Kräftespiel: "Die private Entsorgungsunternehmen versuchen einen möglichst großen Teil der Wertschöpfungskette zu kontrollieren, das könnte die Transparenz vermindern." Und die Müllgebühren nach oben treiben.