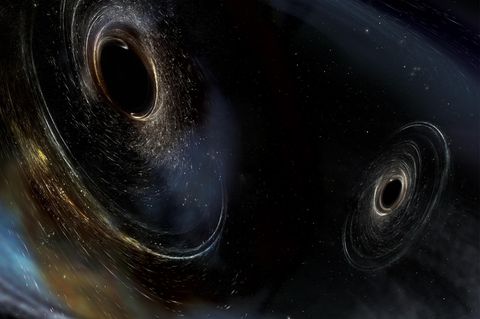Wie sehen die Fragen bei Pisa 2003 aus?
Ganz ähnlich wie die von Pisa 2000. Alltagsnah, reizvoll, interessant für Jugendliche. Es wird wieder Fragen zum Ankreuzen geben und solche, bei denen man die Antwort selbst formulieren muss, aber das Spektrum ist viel breiter. Auch der Schwerpunkt wird ein anderer sein: Mathematik statt Leseverständnis.
Wann wird getestet?
Zwischen Mai und Juni kommenden Jahres. Es wird auch dann wieder zwei Teile geben, einen internationalen Vergleich, an dem in Deutschland etwa 10.000 Fünfzehnjährige von 220 Schulen teilnehmen, und einen nationalen Vergleich mit weiteren 1.300 Schulen.
Erwarten Sie, dass unsere Schulen 2003 besser abschneiden?
Das wäre eine große Überraschung. Bildungssysteme verändern sich langsam. Fünfzehnjährige haben immerhin neun Jahre Schule hinter sich. Es wäre vermessen, zu glauben, nach knapp eineinhalb Jahren könnten sie schon einen großen Sprung nach vorn machen.
Also mehr Bescheidenheit? Die verkauft sich nicht gut im Wahlkampf.
Die Politik sollte sich vor großen Versprechungen hüten. Wir werden selbst in vier Jahren noch nicht ganz vorn mitmischen. Schließlich verbessern sich auch die Bildungssysteme anderer Staaten. Wenn wir langsam und kontinuierlich besser werden, wäre das ein Riesenerfolg.
Parallel zu Pisa gibt es nächstes Jahr Untersuchungen wie Desi, die Deutsch- und Englischkenntnisse von Neuntklässlern testet. Hilft uns diese Testeritis, oder verunsichert sie nicht noch mehr?
Wir müssen uns erst an diese Vergleiche gewöhnen. Die sind anderswo - in Finnland, England, Australien - längst die Regel. Allein Testen um des Testens willen wäre allerdings fatal. Dem deutschen Lehrer ist es auch bisher nicht schwer gefallen zu prüfen. Solche Tests haben nur Sinn, wenn sie professionell gemacht sind, Stärken und Schwächen ebenso zeigen wie Ansätze zur Veränderung.
Wie gehen andere Nationen mit ihren Testergebnissen um?
Viel sachlicher. Im Gegensatz zu uns Deutschen fühlen sie sich nicht als Versager, selbst wenn sie mal nicht so gut abschneiden. Wir müssen lernen, die Tests als diagnostische Information zu nehmen: Wo stehen wir, was können wir besser machen, anstatt mit dem Finger auf die zu zeigen, die etwas schlechter sind ...
... wie nach dem Ländervergleich. Die Kultusministerinnen von Bayern und Baden-Württemberg triumphierten.
Beide Länder haben international gesehen immer noch großen Entwicklungsbedarf.
Was kann beispielsweise Bremen von Bayern lernen?
Beide Länder sind schwer zu vergleichen, denn Bremen ist ein Stadtstaat mit einer sehr hohen Ausländerquote an den Schulen, und Bayern ist ein Flächenstaat mit vorwiegend ländlichen Gebieten. Natürlich hat es Bremen da schwerer. Erstaunlich ist aber, wie es die Bayern schaffen, dass ihre schwachen Schüler besser sind als anderswo. Bayern liegt vorn, weil die Hauptschüler besser sind als anderswo.
Der Grund?
Mehr Konsequenz, klare Forderungen, während anderswo solche Schüler schon aufgegeben wurden.
Was sollten Eltern tun?
Eine dramatische Erkenntnis von Pisa war, wie ungern deutsche Schüler lesen. Die Verantwortung dafür liegt im Elternhaus. Eltern müssen ihren Kindern von klein auf zeigen: Gemeinsam schmökern macht Spaß. Lesen ist nicht nur ein intellektuelles Vergnügen, sondern Basis für alles Lernen in unserer Gesellschaft, auch am Computer. Allerdings sind Eltern eine Gruppe, die wir nur schwer beeinflussen können. Schwedische Schulen haben das Problem pragmatisch gelöst: Dort gibt es jeden Morgen eine Lesestunde. Dann nimmt sich wirklich jedes Kind ein Buch und liest.
Interview: Ingrid Eissele