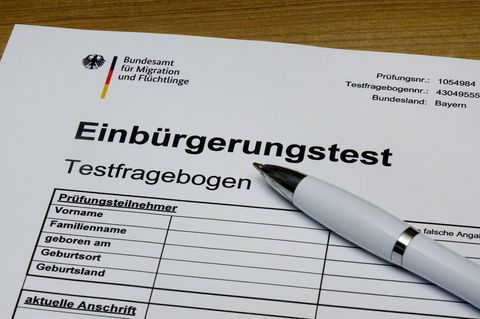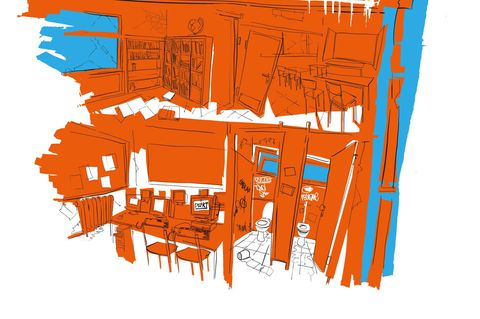Endlich. Das sogenannte Startchancenprogramm der Ampel-Regierung kann ab dem 1. August zum kommenden Schuljahr 2024/25 starten. Monatelang hatten Bund und Länder darüber verhandelt, jetzt steht die Einigung. Bundesweit sollen 4.000 Schulen in sozial schwierigen Lagen gefördert werden. Berlin will jährlich bis zu einer Milliarde Euro bereitstellen, die Länder sollen nochmal eine Milliarde obendrauf legen. Bei einer Laufzeit von zehn Jahren sollen insgesamt 20 Milliarden Euro für Schulen in Brennpunkten bereitgestellt werden. "Das ist das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland", sagt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP).
Recht hat sie, die Summe ist eine Ansage. Und immerhin scheint es kein Gezänk in der Koalition zu geben. Es wird aber auch Zeit. Denn nach dem schlechten Abschneiden der deutschen Mädchen und Jungen bei der jüngsten PISA-Studie, die im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, hatte es bislang keine nennenswerte Reaktion von Seiten der Bildungspolitik gegeben. Dabei machten die schlechten Ergebnisse ein weiteres Mal deutlich, wie schlecht es um die Bildung in Deutschland steht. Unter den sogenannten Risikoschülern und -schülerinnen, die nicht ausreichend lesen oder rechnen können, finden sich vor allem Jugendliche aus Familien, die von Armut betroffen sind.
Deutschland ist ungerecht
In kaum einem Land hängt der Erfolg in der Schule so stark vom Elternhaus ab wie in Deutschland. Kinder aus armutsbetroffenen Familien oder solche, bei denen zu Hause kaum Deutsch gesprochen wird, haben schlechtere Chancen in der Schule. Bisher schafft die Schule es nicht, die ungleichen Startbedingungen auszugleichen, sondern verfestigt sie sogar noch: So haben Kinder ungelernter Arbeiter eine sechsfach schlechtere Chance, Abitur zu machen und zu studieren.
Investitionen wie das jetzt beschlossen Start-Chancenprogramm sind vor diesem Hintergrund richtig und sinnvoll. Denn das Programm wird über zehn Jahre laufen und wissenschaftlich evaluiert werden. Die Zahl der Mädchen und Jungen, die die Mindeststandards in Mathe und Deutsch verfehlen, soll an den teilnehmenden Schulen halbiert werden. Gut zudem, dass mit dem Geld auch multiprofessionelle Teams an den Schulen gestärkt werden sollen, also zum Beispiel Schulsozialarbeiter eingestellt werden könnten.
Startchancen-Programm für Brennpunktschulen: Wer bekommt das Geld?
Und damit zum Aber: Anders als von Experten und Experten während der monatelangen Diskussionen gefordert, wird das Geld auch diesmal nicht ausschließlich streng nach sozialen Kriterien, sondern wieder mit der "Gießkanne" verteilt. Dabei sind Armut und Bildungsarmut in Deutschland höchst ungleich verteilt: Vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg und Berlin ballen sich Schulen mit hohen Anteilen armer Kinder. Während in Gelsenkirchen nach einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung im Jahr 2022 fast 42 Prozent der Kinder von Sozialleistungen lebten, waren es im bayerischen Roth nur 2,7 Prozent.
Zwar wird das Geld beim Startchancen-Programm nicht wie sonst üblich nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel vergeben, wonach reiche Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg mehr Geld bekommen als arme Bundesländer, obwohl sie weniger Schulen in schwierigen sozialen Lage haben. Aber Nordrhein-Westfalen beispielsweise erhält beim Startchancen-Programm voraussichtlich mehr Geld, Berlin allerdings weniger als nach dem alten Verteilungsschlüssel. Das zeigen erste Berechnungen des "Expert:innenforum Startchancen". Der erhoffte Paradigmenwechsel ist das nicht.
Unterstützung für eine Million Schülerinnen und Schüler
Mit dem Startchancenprogramm werden rund eine Million Schülerinnen und Schüler an 4.000 Schulen unterstützt. Geplant ist, dass die Bundesländer die Schulen selbst aussuchen. Das ist ein guter Anfang, ein Signal. Mehr nicht, denn in Deutschland gibt es rund 32.600 Schulen mit 8,7 Millionen Kindern.
60 Prozent der geförderten Schulen sollen Grundschulen sein. Es müssten aber noch viel mehr sein, denn aus der Forschung weiß man: Vor allem am Beginn einer Bildungsbiografie brauchen gerade Kinder aus sozial-benachteiligten Familien Unterstützung. Jeder Euro, der hier investiert wird, ist gut angelegt und zahlt sich langfristig aus. Für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Denn die Wirtschaft braucht langfristig gut ausgebildete Fachkräfte. Bisher wurde viel zu lange akzeptiert, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler im Schulsystem scheitert. Das kann sich Deutschland in Zukunft nicht mehr leisten.
Für eine wirkliche Lösung der Bildungskrise reicht das Programm nicht, dazu bräuchte es mehr Mut, mehr Entschlossenheit und wahrscheinlich auch noch mehr Geld – für einen Digitalpakt 2.0 sowie eine breite Investition zum Ausbau der Kitas. Vor allem bräuchte es grundsätzliche Reformen im Bildungswesen.