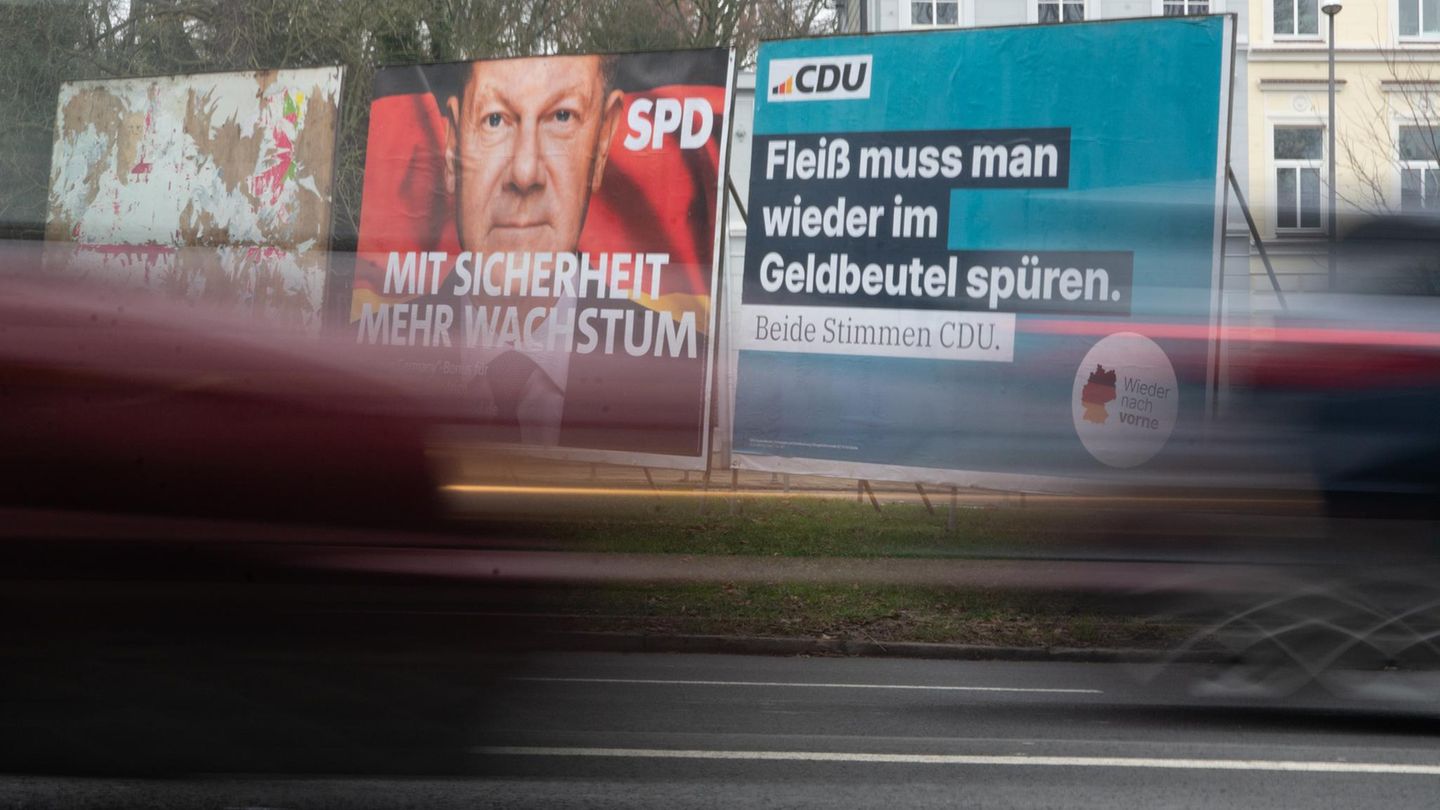Deutschland steckt gesellschaftlich zumindest mental noch tiefer in der Krise als angenommen. Das jedenfalls ist der Eindruck, den eine neue Studie des Kölner Rheingold-Instituts vermittelt, die heute veröffentlicht wurde. Für die Untersuchung hat das Team um Institutsleiter Stephan Grünewald zwischen dem 13. und 23. Januar tiefenpsychologisch fundierte Interviews mit 50 Wählerinnen und Wählern geführt. Die Parteienaffinität der Befragten entsprach der Stimmenverteilung der Wahlumfragen in der ersten Januarhälfte. Zwar ist die Studie nicht repräsentativ, doch sie bildet, so das Institut, "als qualitative Studie die oft nicht thematisierten Ängste, Sehnsüchte und Wahrnehmungsmuster der Wählenden" ab.
"Keine Rettung in Sicht" – so fasst das Rheingold-Institut seine Studie zusammen
Die Ergebnisse sind erschreckend: "Die Stimmung vieler Wählender vor der kommenden Bundestagswahl ist von starken Verlustgefühlen, Sorgen und Enttäuschung über die Politik geprägt. Die Konsequenzen einer stotternden Wirtschaft, fehlgesteuerter Migration und bröckelnder Infrastruktur dringen zunehmend in den Alltag ein und erzeugen das Gefühl, in einem Problemstau ohne Ausweg festzustecken", heißt es in einer Pressemitteilung des Rheingold-Instituts. Überschrift des Papiers: "Keine Rettung in Sicht".
Dabei stellt Diplompsychologe und Institutsgründer Stephan Grünewald bei den Wählenden gleich ein Gefühl der "dreifachen Ausweglosigkeit" fest: "Es fehlt an überzeugenden Zukunftskonzepten und Visionen, es fehlt der Politik an überzeugenden Kandidaten, und es gibt keine mögliche Koalition, die die Menschen überzeugt."

Was auch fehle: eigene Beruhigungsstrategien. Bisher sei der Rückzug ins Private eine Möglichkeit gewesen, dem Krisengefühl zu entkommen. Viele Menschen hätten vor ihr "Schneckenhaus" einen "Verdrängungsvorhang" gehängt. Jetzt aber, so der Psychologe bei der Präsentation der Studie, schwappten die politischen und gesellschaftlichen Probleme durch diesen Vorhang in den privaten Alltag der Menschen. Zu merken etwa an maroder Infrastruktur, nicht mehr verlässlich funktionierenden Kitas oder Schulen oder am schwierigen Wohnungsmarkt. Grünewald: "Es herrscht ein Groll auf die Politik. Das Gefühl ist: Was haben die uns eingebrockt? Das wird fast wie eine Art Alltags-Sabotage wahrgenommen."
Bezogen auf die Vergangenheit scheine bei den Befragten ein Gefühl der Kränkung auf. Blicke man auf die Gegenwart, sei der vorherrschende Eindruck Verwirrung und Ratlosigkeit. Und blicke man auf die Zukunft, manifestiere sich ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit.
"Das Grundgefühl der Menschen ist: Das Land steckt in einem gewaltigen Problemstau fest", so Grünewald. Das Erleben von Dauerkrisen wie Klimakrise oder Ukraine-Krieg würde jetzt verstärkt durch den Eindruck, dass das eigene Land nicht mehr funktioniere. "Das Sicherheitsgefühl der Leute ist nach den jüngsten Anschlägen erschüttert, und das Thema Migration bleibt akut. Zweiter Eindruck: Der Alltag ist belastet durch Inflation und sinkender Kaufkraft. Und die Infrastruktur wird als drittes großes Problem wahrgenommen. All das verdichtet sich zu einem Gefühl: Aus made in Germany ist marode in Germany geworden."
Nachspielzeit statt Zeitenwende
Die von Kanzler Olaf Scholz ausgerufene "Zeitenwende" sei nicht im Erleben der Menschen angekommen. "Stattdessen haben sich die Menschen in einer Art Nachspielzeit eingerichtet. Die Hoffnung war: Wir spielen auf Ergebnis halten. Wir können die Zustände, wie wir sie kennen, vielleicht noch ein paar Monate oder Jahre halten", sagt Grünewald. "Jetzt merken die Menschen: Die Nachspielzeit ist unwiderruflich zu Ende."
Es gebe eine Sehnsucht nach einem "fürsorglichen und starken Krisenmanager, der Deutschland im Blick hat" – also nach einer Art Vaterfigur. Stattdessen habe es in der Ampel nur "Bruderzwist" gegeben – was die Menschen gekränkt habe.
Wo ist Pistorius?
Eine zweite Kränkung bestehe darin, dass jener Politiker, dem die Menschen am ehesten eine Führungsrolle und Klartext zutrauten – Verteidigungsminister Boris Pistorius – nicht als Kanzlerkandidat angetreten sei. "Aus Sicht vieler Wähler wurde diese Option zugunsten des persönlichen Machterhalts nicht umgesetzt", heißt es in der Pressemitteilung. Das verstärke den Vertrauensverlust.
Generell werde die Stimmung in Deutschland als zunehmend explosiv wahrgenommen. Die Wahrnehmung der Lage zeige ein gespaltenes Land. So heißt es in der Pressemitteilung des Rheingold-Instituts weiter: "Mitunter hat man in den Tiefeninterviews den Eindruck, dass die befragten Wählenden in komplett unterschiedlichen Wirklichkeiten leben und die Welt vollkommen anders wahrnehmen. Das eher links-bürgerliche Lager fürchtet den 'Untergang des Abendlandes', falls die AfD an die Macht kommen sollte. Dieses Lager beschwört die Normalität, kämpft für den Erhalt des Status quo, idealisiert mitunter die Zustände, ringt um die Demokratie und sieht sich als Bollwerk des Guten. Es hofft, dass sich der Problemstau durch demokratischen Einsatz wieder in Wohlgefallen auflöst."
Systemsprenger AfD?
Das eher konservative oder AfD-nahe Lager habe hingegen eher das Gefühl, dass Deutschland sich bereits mitten im Untergang befinde. Dieses Lager fühle sich "heimatlos im eigenen Land", zeige sich "wütend und fordernd" und verlange einen radikalen Durchgriff und eine entschiedene Wende zurück zu alter Stärke. "Gleichzeitig verstärkt die gefühlte Ausweglosigkeit in der festgefahrenen Situation eine latente Sehnsucht, den Problemstau entschieden oder radikal aufzulösen", so die Meinungsforscher. "Angesichts der riesigen Probleme erscheinen Stillstand und ein bloßes 'Weiter so' zunehmend bedrohlich. Diese Gefühle bedient die AfD mit der Verheißung, das System 'sprengen' zu können."
"Menschgewordene Wärmepumpe"
Das Rheingold-Institut fragte auch nach subjektiven Einschätzungen zu Spitzenpolitikern. Einige Ergebnisse:
- Kanzler Olaf Scholz gelte als "Sinnbild für den Stau", als "Projektionsfläche für alles, was schiefläuft", als "Mann der kleinen Schritte", der nicht ausreichend kommuniziere, der bei der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner allerdings Profil gezeigt habe. "Scholz wird viel für das Gefühl der Kränkung verantwortlich gemacht", so Grünewald.
- Friedrich Merz erscheine zwar "selbstbewusst", wobei dieses Selbstbewusstsein laut der Befragten aber auch in "Arroganz umschlagen" könne. Man wisse auch nicht genau, welchen Kurs Merz eigentlich einschlagen wolle. Ein Kandidat der Herzen sei Merz eher nicht.
- Robert Habeck sei von einem Befragten als "menschgewordene Wärmepumpe" bezeichnet worden. Habeck setze in der Wahrnehmung der Studienteilnehmenden auf Augenhöhe zum Bürger, doch es seien auch Zweifel an seiner Kompetenz und seiner Durchsetzungsfähigkeit geäußert worden. "Er erscheint nicht als starker Vater, sondern eher als der gute Onkel."
- Christian Lindner habe bei der Befragung fast keine Rolle mehr gespielt. Dies sei umso erstaunlicher, als dass der Liberale vor Beginn der Ampelkoalition noch als eine Art "Befreier" wahrgenommen worden sei, der für die Freiheit kämpfe.
- Alice Weidel sei als der "absolute Gegenpol zu Angela Merkel" beschrieben worden. "Eine Art unterkühlte Eiskönigin oder aristokratische Scharfrichterin". Weidel sei die Kandidatin, die zwischen Begeisterung und totaler Ablehnung am meisten polarisiert habe.
- Sahra Wagenknecht sei als "schwer greifbar" wahrgenommen worden. Einerseits habe man sie als "Lichtgestalt" oder "Friedensengel" charakterisiert, andererseits erschiene sie, so Grünewald, "in ihrer Losgelöstheit solitär und weder an ihre Partei noch an die Menschen wirklich angebunden".
Alles Krise also, ohne Hoffnung auf Besserung? Nein! Die Befragten wünschten sich, so Grünewald "richtungsgebende Geschlossenheit". Die Probleme im Land müssten klar benannt werden, Herumlavieren funktioniere für die Interviewten nicht mehr.
"Vieles liegt gerade brach. Es gibt viel gestaute Bewegungsenergie im Land", so der Psychologe. Um diese Energie zu nutzen, sei dreierlei notwendig: Klare Ziele, die für alle gelten. Ein Schulterschluss. Und klare Kommunikation darüber, was der Einzelne leisten kann. So könnte aus individueller Selbstwirksamkeit so etwas wie gesellschaftliche Selbstwirksamkeit werden. Das habe in anderer Form schon einmal funktioniert: Während der Energiekrise, als die Menschen gemeinsam handelten – und die Heizungsthermostate herunterdrehten, um Gas zu sparen.