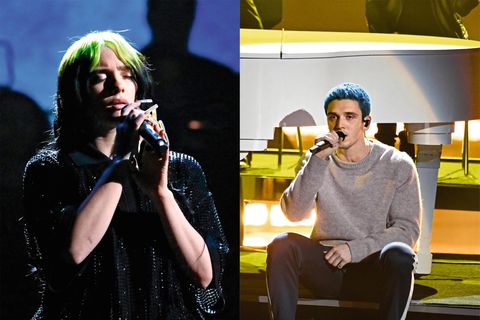Da stehen sie, fünf Realschüler auf der Terrasse, und sagen: "Wir sind die Schwarzen von Baienfurt." Sie meinen das ernst. Ein Dörfchen bei Ravensburg, Kevin und seine Kumpel tragen Basecap und Panzerketten, Shirts und Hosen in Übergroß. Sie sind 15 - und HipHopper. Die kleinen Gesichter umschattet von wuchtigen Basecaps, Bübchenschmelz in den Wangen, die Münder trotzig aufgeworfen. Kevin nimmt einen Schluck vom Bananenmilkshake, sein Kehlkopf hüpft auf und ab. Die Kinder sehen sich als Ghettokids - auch wenn hier nicht Los Angeles ist, sondern Oberschwaben. Mit Zwiebeltürmchen und freundlichen Kühen, mit Badeseen und einer Landschaft, die wie eine weiche Umarmung ist. Aber heute ist alles möglich, überall.
Da kommt sie vom Baden, Lucy in Hamburg, sie ist 15, die Sonne spielt mit ihren schwarzen Haaren, in denen noch ein paar Wassertröpfchen glitzern. Sie ist niedlich, Kindchenschema und Kurven, trägt über dem Restbabyspeck ein rotes Nikkishirt mit Kapuze, dazu Jeans und weiße Söckchen. Lucy sagt: "Es gibt verschiedene Arten von Liebe. Die Liebe zu einem Mann, aber auch die zu einer Freundin." Dabei sitzt sie im Gras und rollt Gänseblümchenstängel zwischen den Fingern. Wenn Lucy in zehn Jahren nicht verheiratet ist, will sie ihre beste Freundin heiraten. Eine von ihnen macht dann den Haushalt, die andere den Beruf. Und natürlich darf jede auch einen Freund haben. Lucy, die mal Stewardess werden will, meint das sehr ernst. Früher hätte man gesagt: Teeniespinnerei. Heute sagt man: ein Lebensentwurf, der gar nicht so unrealistisch ist, wenn man 15 Jahre alt ist im Jahr 2007. Wo alles möglich ist. Keine andere Jugend hatte je ein solches Überangebot an Lebensalternativen, eine derartige Menge an Informationen und solche vielfältigen Möglichkeiten. Amerika- oder Frankreichjahr? Halbe-halbe!
Die Ausrichtung auf die Lebensplanung findet immer früher statt
Die Eltern lassen sich scheiden? Die Hälfte der Woche bei Mama, die andere zu Papa. Hetero? Schwul? Bi geht auch, kein Problem. Reich sein, ohne etwas gelernt zu haben? Dafür gibt es Castings bei Dieter Bohlen. Die Jugend ist ein Märchen: Hänsel und Gretel verlaufen sich im Wald. Dicht und dunkel ist er und hat so viele Wege. Rechts rum, links rum? Oder zurück? Zukunft ist ein fernes Land, die Gegenwart ein Dickicht. Sie tapsen mit Sneakers und Basecap durch das Gestrüpp der Möglichkeiten, beharrlich suchend nach dem rechten Weg. Wo, bitte, geht’s zum Lebensglück? Die Jugend ist anders geworden, dabei sind die Jugendlichen gar nicht so viel anders als früher. "Aber die Ausrichtung auf die Lebensplanung findet immer früher statt", sagt Michael Schulte-Markwort, Professor für Kinder- und Jugendpsychosomatik an der Universität Hamburg. Früher, das bedeutet auch: immer tiefer in der Pubertät.
Auf Kevins Terrasse, wo die Gangsta- Rapper von Baienfurt rumhängen, entwickelt sich ein klassisches Liebesdrama. Keiner hat einen Plan, wohin man gehen könnte. In Kneipen bekommen sie keinen Alkohol. "Mit 15 kann man nichts machen außer strafbar sein", sagt einer. Ebro, die hübsche Freundin von Kevin, erzählt, wie ätzend dieses ganze Ausgehen oft ist: Man sitzt rum auf einem Bänkchen und säuft, na toll. Irgendwann steuern sie die Turnhalle an, dunkel wird es gerade, jemand, der alt genug ist und zufällig vorbeikommt, besorgt bei Penny Erdbeerlimes, einen hochprozentigen Drink aus Erdbeerpüree. Dazu Cola und Rum. Sie prosten sich mit dem bonbonfarbenen Gebräu zu, das dickflüssig in den Plastikbechern schwappt. Regen fällt sanft, und der Alkoholpegel steigt. Ebro und Kevin geraten aneinander. Sie gehen runter zur Wiese, sie gestikulieren, immer heftiger, sie schreien sich an. Irgendwann rennt Kevin einfach los, rennt und rennt, und Aziz packt die Rumflasche, rennt Kevin hinterher, Ebro kommt wieder zur Turnhalle, von Tränen geschüttelt, "es ist aus", sie sagt das ganz tonlos, die beiden anderen Mädchen umarmen sie, streicheln sie, weinen auch, wie ein Dreierstern sind die bebenden Köpfe aneinandergesteckt, es ist aus.
Die Jugendlichen müssen heute viel früher entscheiden
Auch der Erdbeerlimes ist leer und der Abend vorbei, zehn vor elf ist es, um elf muss Ebro zu Hause sein. Schluchzend macht sie sich auf den Heimweg. So anstrengend ist sie, so ermüdend, diese Scheißpubertät. "Die Pubertät ist die Lebensphase, in der Identität und Autonomie entwickelt werden müssen", sagt Schulte-Markwort. Die Sexualität erwacht, der Körper verändert sich, und die Gefühle erst! Aber wie gehe ich damit um? "Diese Schwierigkeiten sind notwendig", sagt Schulte- Markwort, "von ihnen hängt ab, unter welchen Bedingungen ein junger Mensch sich weiterentwickeln kann." Das allein wäre ja schon Herausforderung genug für einen 15-Jährigen, eine 15- Jährige. Aber dann ist da noch die große Freiheit, dieses Alles-ist-erlaubt, die einerseits viele Chancen birgt, andererseits die Qual der Wahl. Denn mit den Möglichkeiten steigen auch die Erwartungen, zum Beispiel der Eltern.
So lebt Marcel, 15: Er geht in Weingarten in Baden-Württemberg auf die Realschule, 10. Klasse. Nach einem Mittagessen mit Schnitzeln, der Oma, den Eltern und den beiden Brüdern marschiert er zur Englisch-Nachhilfe. Der Nachhilfelehrer heißt Jack und kommt aus England. Marcel verehrt ihn: Er war Kampfschwimmer bei der Marine, hat in Shanghai und Malaysia gedient und knallt ihm jetzt die "New York Times" auf den Tisch: "Übersetzen!", donnert er. Jack ist ein riesiger tätowierter Seebär mit grauem Bart, seit Marcel zu ihm geht, hat sich der Junge steil verbessert in Englisch. Nächstes Jahr steht für ihn die mittlere Reife an, zum Entsetzen seiner Eltern will Marcel dann Friseur werden. Die sähen ihn lieber als Industriekaufmann. Die Jugendlichen müssen heute viel früher entscheiden, wohin ihr Leben sie führen soll, sie müssen viel früher begreifen, was notwendig ist im Leben. Da bleibt kaum Raum fürs Ausprobieren, denn der Zeitdruck pocht im Nacken. Wer zu spät kommt, den bestraft der, der schneller war.
Optimale Startbedingungen oder Resignation
Es gibt zwei Extreme, mit diesem Druck umzugehen: Die Jugendlichen versuchen entweder mit allen Mitteln, optimale Startbedingungen zu schaffen, oder sie resignieren zu früh. Bleiben sitzen im Finsterwald und trauen sich nicht. Hier driften die Schichten auseinander: In dem Maße, wie sich Gymnasiasten selbst an die Kandare nehmen und mit der Zeitökonomie eines Managers ihre Ausbildung optimieren, "geht die Leistungsbereitschaft an den Hauptschulen kontinuierlich zurück", sagt Anke Pijahn, 36, Hauptschullehrerin in Bielefeld. Auf die Frage, was sie werden wollen, antworten die Schüler: "Zuhälter." Zynische Einsicht in die eigene Chancenlosigkeit. Gymnasiasten finden sich dagegen oft in einem Förderkarussell aus Tennisstunden, Russischunterricht und Auslandsjahr wieder, das sich immer schneller dreht. Das Auslandsjahr zum Beispiel kommt inzwischen häufig zu früh: "Die Schüler sind oft noch viel zu jung", sagt Professor Schulte- Markwort.
"Diese forcierte Beschleunigung birgt die Gefahr, dass die Kinder nicht nachreifen, dass sie sich zunächst erwachsener verhalten, als sie es aufgrund ihrer psychischen Konstitution wirklich sind." Denn irgendwo zwischen Karriereplanung oder früh gereiftem Zukunftsfrust muss sich noch das drängen, was eigentlich Aufgabe des Großwerdens ist: die persönliche Entwicklung. Wo den früheren Generationen ein klarer Kompass aus Werten, Konsens und Verbindlichkeiten an die Hand gegeben wurde, kann das Navigationssystem der Jugend 2007 schnell wegen Überladung kollabieren. Gerade beim zentralen Thema - Sex. "Jugendliche wachsen in einer Gesellschaft auf, in der Sexualität generell eine größere Bedeutung hat als früher", sagt Dr. Eveline von Arx, die Leiterin des Dr.-Sommer- Teams der "Bravo". "Die Vielfalt dessen, was erlaubt ist, ist enorm gestiegen. Es gibt weniger Tabus zu brechen, und so sind gewisse Dinge selbstverständlicher geworden. Mit den umfangreicheren Wahlmöglichkeiten wächst auch die Erwartung, was man wann tun muss, um ‚normal‘ zu sein."
Eltern sind liberal und bevorzugen partnerschaftliches Verhältnis
Doch werden diese Wahlmöglichkeiten nicht ausgeschöpft. Das Sexualverhalten der Mehrheit der Jugendlichen hat sich nicht wesentlich verändert in den vergangenen Jahren. Der erste Sexualkontakt findet bei den meisten Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren statt, jeder dritte 17-Jährige lässt sich damit sogar noch Zeit. Gerade 13 Prozent der 14-Jährigen verfügen bereits über sexuelle Erfahrung, so eine Studie der "Bravo" von 2006. Eine Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung belegt, dass sich der Zeitpunkt des sexuellen Erstkontaktes in den vergangenen 20 Jahren nicht nach vorn verschoben hat. Der Umgang mit Sexualität ist eher pragmatisch. Marcel aus Oberschwaben war 14, im Urlaub in Kroatien ist es passiert. Er hat keine Freundin und sucht auch keine. "Ach, Sex ist zum Spaßhaben. So wahnsinnig wichtig ist das nicht", sagt er. Sex ist einfach Bestandteil des Lebens - neben den Kumpels, neben dem Sport. Früher war es der Sex, mit dem man die Eltern richtig nerven konnte. Aufbegehren, Widerstand, sich selbst erproben. Die Überschreitung von Grenzen war wichtig, um zu lernen, sich selbst zu spüren. Aber was, wenn Grenzen schwer zu finden sind?
"Kann ich so gehen, Kim?", fragt in Hamburg-Alsterdorf eine Mutter ihre Tochter. "Ach, mach die Jacke ein bisschen weiter auf ", rät Kim, 15, und guckt kritisch, während sie die blonden Haare zurückstreicht. Nele, die Freundin von Kim, erzählt: "Neulich hat sich mein Vater alles von mir erzählen lassen, und dann hat er gesagt, er war genauso, als er ein Junge war. Ich kann ihn super alles fragen, was Jungs angeht." Nie haben sich Kinder mit ihren Eltern so gut verstanden wie heute. 90 Prozent der Jugendlichen pflegen ein konfliktfreies Verhältnis zu ihren Eltern, hat die Shell- Jugendstudie 2006 ermittelt. Eltern sind liberal und bevorzugen ein partnerschaftliches Verhältnis zu ihren Kindern. "Nicht die geringste Generationsspannung" attestiert der Soziologe Professor Klaus Hurrelmann von der Universität Bielefeld. Die Generationen umarmen sich, die Kinder übernehmen die Muster der Eltern. Da stimmt etwas nicht, denn die Abgrenzung von den Eltern ist zentral für Heranwachsende. "Die Jugendlichen müssen sich endgültig trennen, um in ihrem Leben selber bestimmen zu können", sagt Psychiater Schulte-Markwort. Aber wie soll man sich als Jugendlicher lösen, wenn die eigenen Eltern am liebsten selbst Jugendliche wären?
Statt Grenzen Harmonie
Sie zapfen den Lebensstil ihrer Kinder an. Mütter und Töchter hören die gleiche Musik, kleiden sich ähnlich. Sie machen permanent Anleihen bei der jungen Generation. Erziehungsministerin Ursula von der Leyen erzählt ganz jung geblieben, dass sie den Kleiderschrank ihrer Töchter plündert. All das muss nicht schädlich sein, immerhin ist es das Ergebnis zahlreicher Generationenkämpfe um mehr Aufgeschlossenheit und Kommunikation. "Eltern sind verständnisvoller geworden, und das ist prinzipiell gut - solange sie keine Marshmellow- Eltern sind", sagt Schulte-Markwort, "Eltern also, von denen keine Reaktion kommt, wenn man reinsticht." Kevin, Kurti und Aziz spielen in Kurtis Zimmer Playstation. Ein Jugendzimmer mit Aschenbechern und Papierkorb, aus dem zerknüllte Tempotaschentücher quellen. Ein Sofa, drüber ein Hochbett, Stringtangabunnies auf Wandpostern und Tupac Shakur. Die Jungs spielen Tekken, sie kuscheln sich wie Bärchen aneinander, zwischen dem Boing, Wumm und Dideldidit der Playstation. Die Mutter ruft von unten nicht "Räum dein Zimmer auf!" oder "Hier drin wird nicht geraucht und schon gar nicht in euerm Alter!" Sondern: "Kurt! Wollen deine Kumpel ein paar Wurstbrote?" - "Ha jaa, gerne" schallt es begeistert aus den Jungskehlen.
Statt Grenzen Harmonie. Aber das Erwachsenwerden findet auch so statt. Früher hat man sich im Wald der Möglichkeiten orientiert, in dem man alles anders machte als die Eltern und einfach den entgegengesetzten Weg beschritt. Heute erleben die 15-Jährigen dank ihrer Eltern die liberalste Jugend, seit es den Stimmbruch gibt. Und der Effekt? Die neuen Ideale und Visionen der Teenager sind vor allem eines: konservativ, ein bisschen eng - fast spießig. Tugenden wie Fleiß und Ehrgeiz sind laut Shell-Studie beim Gros der Jugendlichen durchaus angesagt. Hamburg. Auf einem Alsterkanal schaukeln ein halbes Dutzend hübscher Gymnasiasten auf zwei Tretbooten, sie halten Waffeln mit buntem Eis in den Händen und bieten eine spitzweghafte Spätsommerszenerie. Lara, Kim und Nele sitzen in einem der Boote, die Sonne bricht sich in den Wellen, Trauerweiden kämmen das grüne Flusswasser. In ihrem Französischunterricht schrieben die Mädchen einen Essay: "Was ist Glück?" Aus den gesammelten Aufsätzen wurde ein Büchlein gemacht, nahezu die ganze Klasse schrieb dasselbe: Familie, ein Haus. Vielleicht noch ein Hund. Das sagt auch Kevin, der Rapper aus Baienfurt. Und Marcel, der ja nicht Friseur werden soll. "Der Topos von Haus, Kind und Hund ist höchst verbreitet. Er bedeutet ein psychisches Festhalten an einem Lebensmuster, das Gewissheit und Orientierung verspricht", sagt Soziologe Hurrelmann.
Je weniger Orientierung, desto stärker die Sehnsucht nach Geborgenheit
72 Prozent der Jugendlichen sagen, dass man zum glücklichen Leben eine Familie braucht. Je weniger Orientierung, desto stärker die Sehnsucht nach Geborgenheit. Im Wald ist es finster und auch so bitterkalt. Deswegen glucken sie wie eh und je in den Cliquen und genießen die Nestwärme. In Hamburg-Rahlstedt sitzt Elina, 16, auf der Parkbank im Innenhof der Wohnanlage, ein Kind führt ein Frettchen an einer Leine spazieren. Elina hat sich in der Nacht kleine Zöpfchen geflochten, sodass ihr jetzt Feenlöckchen über ihre Schultern rieseln. Aus einem bordeauxfarbenen Opel dröhnt "Purple Rain". Die Schule ist aus, das Wochenende soll beginnen, Elina spielt mit ihrem Handy, man wartet auf Lucys Anruf. Sie gehen heute aus. Und freuen sich schon so. Im oberschwäbischen Baienfurt finden sich die hungrigen Neuntklässler beim "Istanbul Imbiss" zur Mittagspause ein. Am Tisch werden Zigaretten geraucht und Schokoriegel und Dönersalat und Pommes gegessen. In einer Hand ein Pommes, in der anderen die Zigarette, teilt man sich das Essen, weil manche die paar Euro für den Imbiss lieber in Zigaretten angelegt haben.
Kim und Lara übernachten bei Nele. Unter einem Stiefmütterchenaquarell schlüpfen die drei Mädchen unter ihre Janosch- und Bärchendecken und schlummern. Am nächsten Morgen wachen sie auf, sie blödeln und quieken. "Alle Dreierkuss, los! Mmmpf!", schmatzen sie. Nele setzt sich ans Klavier, sie spielt mit Inbrunst Celine Dions "My Heart Will Go On", und es rührt an, wie die Pyjamamädchen mit den noch schlaftrunkenen Gesichtern die Augen schließen und leise mitsummen. Sie wollen Geborgenheit, die Jugendlichen von 2007. Geborgenheit und Überschaubarkeit in der großen weiten Welt, in der sie leben. "Zu einer guten Jugend gehört das Gefühl, gehalten und begrenzt zu sein", sagt Psychiater Schulte-Markwort. Grenzen also, das Gegenteil von Möglichkeiten. Oder auch: Orientierung statt grenzenloser Freiheit. So finden Hänsel und Gretel wahrscheinlich am besten aus dem Wald.