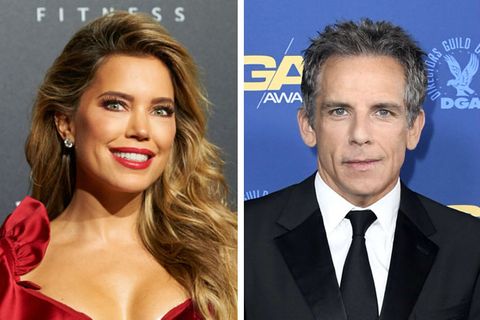Dass Ursula gehen muss, hat sie erfahren, als sie im Frühsommer 2010 in Albuquerque aus der Ohnmacht erwachte und Ärzte ihr sagten, dass der Krebs zurück sei. Dabei sollte die Reise nach New Mexico doch die Rückkehr ins Leben nach dem Krebs sein. Aber dann war Ursula auf einem Ausflug vom Fahrrad gekippt.
Eine junge Frau stirbt an Krebs. Eine Journalistin ist dabei. Ich bin dabei, um über den letzten Weg zu schreiben, den jedes Lebewesen auf die eine oder andere Weise ein Mal geht. Die Sterbende und die Schreibende treffen sich. Keine Grenzen, keine Tabus in den letzten Worten, die man Freunden und Verwandten aus Rücksicht selbst im Sterben lieber verschweigt. "Warst du glücklich? Wann kommt die Angst, und wie sieht sie aus? Hast du jemals gehasst? War es ein gutes Leben?", sind Fragen, die sie besprechen will, wenn es ihr besser geht. Ursula hat immer gern gelacht, häufig auch über den Tod. Doch bald wird das Lachen zu einem sehr schmerzhaften Husten.
Lügen schleichen sich ein, wenn es ihr schlechter geht. "Es wird etwas bleiben", sage ich, die Lebende, die nur an das Hier und Jetzt glaubt. "Denk an das Energieerhaltungsgesetz." Sie sagt: "Ich hoffe nicht auf den alten Mann mit Bart, der alles aufgeschrieben hat. Das könnte dauern." Lachen, Husten, Hoffnung. "Kann ich den Text noch sehen?", fragt sie. "Später", winde ich mich. Soll ich ihr sagen, dass ich noch nicht gewagt habe, auch nur einen Buchstaben ihrer Geschichte zu tippen? Es fühlt sich an, als wären die Worte Erde auf ihrem Sarg. "Solange ich nicht schreibe, stirbt sie nicht", denke ich. Naiv, dumm, verrückt, denn Ursula liegt mittlerweile im Hospiz.
Der Brustkrebs, der sich in Amerika die Lunge geholt hat, steckt nun auch in der Leber und den Knochen, zeigt sich außen als Hautkrebs. Roter Ausschlag an Hals und Schulter, der ihr mehr Angst macht als das CT-Bild der Lungenmetastasen, die ihr den Atem nehmen: "Es sieht fast schön aus, dieses kleine, zarte Geflecht. Wie Moos oder Algen. Mal fließt es zusammen, mal auseinander. Ich habe damit geredet: 'Warum tötest du mich? Wir können doch zusammen existieren.' Aber es hat mich, glaube ich, nicht gehört", sagt Ursula in einer langen, ruhigen Minute mit Blick auf das graue Abbild des Todbringers. Herbst. Das bunte Laub mächtiger Bäume rauscht vor dem Fenster. Knapp zwei Jahre ist es her, dass sie zum ersten Mal erfahren hat, dass sie diese Krankheit in sich trage, die in Deutschland die zweithäufigste Todesursache ist. Die vor fünf und sechs Jahren auch ihre Eltern getötet hat.
Der Hund in der Falle
Mammakarzinom, lautete die Diagnose für Ursula am 27. Oktober 2008. Die damals 42-Jährige wehrte sich mit der Amputation einer Brust und drei Chemotherapien. "Wie ein Hund, der in der Falle steckt, und sich ein Bein abbeißt." Ursula war immer eine Sportskanone. Laufen, Radfahren. Das Gesundwerden sah sie genauso als Wettkampf wie das Sterben. "Die Königsdisziplin ist das Loslassen." Zu ihrer Ausrüstung gehörte, viel über die Krankheit zu reden. Sie führte Blogs, zeigte bei einem Fotoshooting für Frauen mit Brustkrebs die Schönheit des Überlebens mit einem wiederaufgebauten Busen, gab Interviews. Ursula war promovierte Sprachwissenschaftlerin. Sie wusste, dass Monster kleiner werden, wenn man sie genau beschreibt. Warum nicht auch das größte aller Monster, der Tod?
Naiv war sie nie. Eine Liebesbeziehung und Freundschaften zerbrachen, weil Ursula sich dem Optimismus verweigerte. Aus dem gleichen Grund hat sie später ein Blog geschlossen: "Ich weiß nicht, was die Leute wollen, die ausgerechnet hier um jeden Preis diese 'Klischee-Hoffnung' - mein Überleben - suchen. Ich weiß nur, dass es mich zu sehr anstrengt, immer wieder bei Null anzufangen." Sie wollte keinen "süßlichen, falschen" Trost. "Auch der letzte Campari schmeckt gut! Die Endlichkeit des Lebens ist schön, die Wahrheit ist schön!", so ihre Worte, und sie rechnete jedem vor, wie viel Zeit ihr noch bliebe - ob man es hören wollte oder nicht.
So hart wie gegen andere war sie gegen sich selbst, trug die Haare grell blondiert - zum "auf Abstand halten". Der fragile Körper war bis zuletzt drahtig trainiert. Kontrolle behalten. Nach der ersten Schlacht mit dem Krebs hatte sie versucht, den eigenen Leib mit Magersucht zu disziplinieren. Als im Frühjahr 2010 klar war, dass der Krebs gewinnen würde, überlegte sie, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen. Nach einer letzten großen Party.
"Sie haben noch gar nicht begriffen, dass sie sterben werden", sagte damals ihr Onkologe. Ein Mann, den Ursula für seine Ehrlichkeit schätzte: "Sie können mich alles fragen, aber Sie müssen mit der Antwort leben können", so seine Ansage. Sie hat sich nie getraut, ihn nach dem Wann und Wie zu fragen. Denn je näher der Tod kam, desto mehr hing sie am Leben.
Die fünf Phasen des Sterbens
Was tut ein Mensch, der erfährt, dass er bald aus dem Leben gerissen werden wird, dessen Ende bisher in unvorstellbarer Ferne lag? Fünf Phasen hat die schweizerisch-amerikanische Begründerin der Sterbeforschung Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) identifiziert: Verdrängung, Wut, Verhandlung, Depression, Akzeptanz. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. "Ich war gar nicht richtig wütend", hat Ursula einmal gesagt. Manchmal vergesse sie, dass sie sterben muss. "Sogar oft. Das ist wie mit Liebeskummer: Du wachst auf, und es geht dir eigentlich gut. Dann fällt es dir wieder ein, und das ist traurig. Wie ein nasses Tuch, das über einen fällt." Anfangsphase.
Ursula stand mit ihrem Todesurteil ziemlich allein da. War genauso hilflos wie Freunde und Verwandte. Den Onkologen ("für die Fakten") und einen Psychologen ("für die Gefühle") suchte sie sich selbst. In unserer Gesellschaft ist das Verhältnis zum Sterben schwer gestört. "Die Menschen müssen sich damit auseinandersetzen, anstatt es zu verschweigen", forderte sie. Als Mitarbeiterin eines wissenschaftlichen Verlages hatte sie erlebt, wie eine Zeitschrift über die Kommunikation zwischen Arzt und Patient kurz nach Erscheinen wieder eingestellt wurde. "Das wollte niemand lesen."
Von der "Ars Moriendi", einem populären christlichen Wegweiser für die "Kunst des Sterbens" aus dem 15. Jahrhundert mit Anweisungen für alle Beteiligten, ist gerademal die tragisch-trockene Patientenverfügung geblieben, die verhindern soll, dass das Sterben auch noch würdelos wird, weil das reine Am-Leben-Erhalten mittlerweile vor die Lebensqualität getreten ist. Ursula hat Bücher von anderen Sterbenden gelesen, um sich "weniger allein" zu fühlen.
Christoph Schlingensief
"Es ist so, als ob man einen Flugzeugabsturz beobachtet. Dann sind alle ganz furchtbar berührt, weil sie nicht dringesessen haben. Ich sitze aber im Flugzeug", hat Christoph Schlingensief im "Tagebuch einer Krebserkrankung" seine Gefühle beschrieben. Als der Regisseur am 21. August am Krebs starb, verlebte Ursula ihren letzten schönen Tag draußen auf dem Wasser. Da, wo sie glücklich war. Auf ihrem Segelboot auf dem Wannsee, das sie vor zwei Jahren gekauft hat. Schlingensiefs Tod "hat mir einerseits zugesetzt, andererseits fühlt es sich aber auf eine merkwürdige Weise 'gut' an, einen Leidensgenossen so 'schwarz auf weiß' zu haben. Jemand, der vor mir da schon durchgegangen ist."
Vorbereitet ist man trotzdem nicht. "Kann man nicht sein", merkte Ursula am 17. September. Sie kam ins Hospiz. "Ganz plötzlich wurde 'mein' Zimmer frei - das war ein Schock und viele Tränen." Es bedeutete den endgültigen Abschied von ihrer gemütlich-verwinkelten Wohnung. Das Ende der Unabhängigkeit, auch wenn die nur noch mit Sauerstoffflasche aufrechtzuerhalten war. Es war die letzte Station. Das Monster kam näher. Die To-do-Liste lag nun immer griffbereit. Testament, Planung der Beerdigung, Briefe an Freunde, Abschied nehmen von der Welt. "Es wird jetzt eng mit Terminen. Sterben ist ein anstrengender Job", scherzte sie. Lachen, Husten. Sie wollte sogar die Trauerfeier organisieren, schrieb auf, wie die letzte große Party aussehen sollte. "Oh Mann, ich wäre so gern dabei!"
Während sie mit einer bunten Decke über den Beinen in ihrem Bett saß, in diesem hellen Zimmer unterm Dach, und es draußen langsam immer kälter wurde, war es schlicht nicht vorstellbar, dass Ursula sterben sollte. Es würde immer so weitergehen, dachte ich, wie wohl auch alle anderen Besucher. Ursula mailte und simste. Sie war da, auch wenn man nicht neben ihr saß. "Irgendwann wird es einfach umkippen", sagte sie einmal, als könne sie Gedanken lesen. "Sterben ist letzten Endes auch nur ein Teil von dem Match. Ich hoffe, dass ich, wenn es soweit ist, sehe, dass ich das Match verloren habe."
Gut zwei Wochen bevor sie ins Hospiz kam, hatte sie ihr grellblondes Haar "re-naturieren" lassen, zurück zum natürlichen Braunton. Um wieder "sie selbst" zu sein, wie sie sagte. Sie, die immer viel gereist ist, immer in Bewegung und neugierig auf die Welt war, fand, dass sie bei sich selbst angekommen sei.
Trotzdem starb die Hoffnung als vorletztes. In der Nacht zum 9. Dezember ist Ursula gegangen. Sie war 45 Jahre alt.
"Am allerglücklichsten war ich, als ich gemerkt habe, dass ich mein Boot beherrsche, als ich mich getraut habe, das erste Mal ganz allein raus auf den See zu fahren, alles loslassen und den sicheren Hafen hinter mir zu lassen und so ganz allein auf dem Wasser zu sein. Ich hatte so Herzklopfen, und irgendwann habe ich gemerkt: Das geht ja alles."