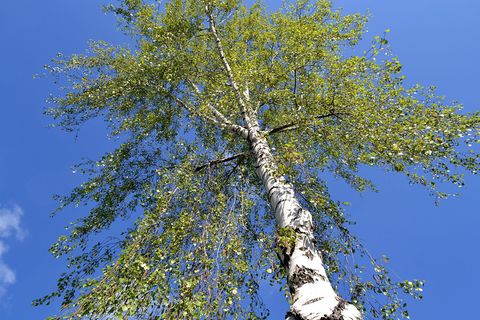Der Provokationstest erfolgt erst nach den Haut- und Bluttests. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen allein genügen nicht für eine Diagnose. Aber sie liefern dem Arzt womöglich Hinweise auf eine Allergie, die er nun mit Hilfe des Provokationstests bestätigen oder ausschließen kann.
Der Test ahmt einen Kontakt nach, den ein Patient mit dem mutmaßlichen Allergie-Auslöser hat. Das Ziel ist, unter medizinischer Kontrolle möglichst milde, aber eindeutige Symptome hervorzurufen.
Der Provokationstest kann in folgenden Fällen angebracht sein:
- Wenn die Ergebnisse der Haut- und Bluttests nicht eindeutig sind.
- Wenn die Testergebnisse nicht zu den Zeitpunkten passen, an denen die Beschwerden auftreten.
- Wenn der Arzt klären möchte, ob es sich um eine echte oder um eine pseudoallergische Reaktion handelt.
- Wenn es wichtig für die Therapie ist, den Auslöser der Symptome genau zu bestimmen. Manchmal stellen die vorherigen Tests eine Überempfindlichkeit gegenüber mehreren Allergenen fest, etwa bei Pollen, deren Flugzeiten sich überschneiden. Der Provokationstest ermittelt dann das relevante Allergen.
Um heftige allergische Reaktionen zu vermeiden, wird der Arzt die Testsubstanz stark verdünnt anwenden und die Dosis schrittweise erhöhen. Trotzdem kann es zu Kreislaufproblemen, zu einem Asthmaanfall oder einem allergischen Schock kommen. Deshalb müssen Provokationstests in der Klinik oder einer gut ausgestatteten Arztpraxis gemacht werden, um den Patienten im Notfall sofort versorgen zu können.
Der nasale Provokationstest
Der Arzt kann mit diesem Verfahren erkennen, welches Allergen einen Heuschnupfen auslöst. Hat er den Verdacht auf ein allergisches Ekzem, kann er mit Hilfe des Tests feststellen, ob Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare die Ursache sind.
Der Patient schnäuzt sich die Nase. Der Arzt schaut sich die Nasenschleimhäute des Patienten genau an und notiert den Ausgangszustand. Zuerst gibt er - als Tropfen oder Spray - eine Kontrolllösung auf die Schleimhaut des besser durchgängigen Nasenlochs. Dann folgt das Allergen in sehr geringer Dosis. Nach 15 Minuten bewertet der Arzt die Symptome: Läuft die Nase stark, schwillt die Schleimhaut an oder ist sie stark gereizt, bricht er die Untersuchung ab. Zeigen sich keine Symptome, wiederholt er den Test mit einer etwas höher dosierten Lösung. Zwischendurch misst er das Luftvolumen, das durch die Nasenhöhle strömt.
Bei Verdacht auf diese Allergene kann sich die Untersuchung lohnen:
- Tierhaare
- Hausstaubmilben
- Schimmelpilze
- Pollen
- Stäube am Arbeitsplatz
Der bronchiale Provokationstest
Der Arzt kann mit diesem Verfahren erkennen, welches Allergen ein allergisches Asthma auslöst.
Mit speziellen Geräten misst der Allergologe die Lungenfunktion. Zunächst inhaliert der Patient die reine Trägerlösung, dann eine Allergenlösung in einer niedrigen Dosis. Im Abstand von fünf bis zehn Minuten untersucht der Arzt, ob sich die Lungenfunktion verschlechtert oder ob der Patient Asthmasymptome zeigt. In diesem Fall bricht er den Test ab. Ist nach 20 Minuten keine Reaktion eingetreten, inhaliert der Patient eine etwas höhere Konzentration des Allergens. Der Arzt setzt den Test so lange fort, bis eine Reaktion eintritt oder der Patient die höchste Konzentration der Allergenlösung inhaliert hat.
Bei Verdacht auf diese Allergene kann sich die Untersuchung lohnen:
- Tierhaare
- Hausstaubmilben
- Schimmelpilze
- Pollen
- Stäube am Arbeitsplatz
Weil beim Test die Gefahr eines schweren Asthma-Anfalls besteht, setzt der Allergologe ihn nur bei Gutachten ein oder nur dann, wenn die anderen Tests für die Diagnose nicht ausreichen.
Der konjunktivale Provokationstest
Der Arzt kann mit diesem Verfahren erkennen, welches Allergen beim Heuschnupfen an den Augen eine Bindehautreizung auslöst. Die Methode wird selten und nur dann eingesetzt, wenn die nasale Provokation kein Ergebnis gebracht hat.
Der Arzt schaut sich dafür die Augenbindehäute des Patienten an. Zunächst zieht er auf einer Seite das untere Augenlid nach unten und tropft eine Kontrolllösung in den Bindehautsack. Im Anschluss daran tropft er eine niedrig dosierte Allergenlösung in das andere Auge. Tritt nach zehn Minuten keine Reaktion ein, setzt er die nächst höhere Dosis ein. Juckt und tränt das Auge, ist es gerötet oder geschwollen, bricht der Arzt den Test ab und spült das Auge mit Kochsalzlösung.
Bei Verdacht auf diese Allergene kann sich die Untersuchung lohnen:
- Tierhaare
- Hausstaubmilben
- Schimmelpilze
- Pollen
- Stäube am Arbeitsplatz
Der orale Provokationstest
Der Arzt kann mit diesem Verfahren erkennen, welches Allergen eine Arzneimittelallergie, eine Nahrungsmittelallergie oder eine Pseudoallergie wie die Milchzucker-Unverträglichkeit auslöst. Der Test ist vor allem dann sinnvoll, wenn eine allergenarme Diät Erfolg brachte.
Der Arzt beginnt den Test, indem er dem Patienten eine kleine Menge des Allergens verabreicht, zum Beispiel einen Tropfen Kuhmilch bei Verdacht auf eine Milcheiweißallergie. Der Patient schluckt die Portion und trinkt etwas Wasser. Alle 30 bis 60 Minuten verdoppelt der Arzt die Dosis, bis die durchschnittliche Essmenge eines Tages erreicht ist oder bis eine Reaktion eintritt. Dazu zählen unter anderem Hautreizungen (Juckreiz, Rötung, Quaddeln, Schwellung), Heiserkeit, Rachenschwellungen, Bauchschmerzen und Durchfall, Schnupfen, ein Asthma-Anfall oder selten ein allergischer Schock. Der Patient sollte 24 bis 48 Stunden unter Beobachtung bleiben, da sich die Symptome auch später noch zeigen können.
Damit die Psyche des Patienten den Test nicht beeinflusst und das Ergebnis möglichst objektiv ist, arbeiten die Allergologen mit einem Trick: Sie geben bei der oralen Provokation abwechselnd Scheinsubstanzen, so genannte Placebos, und echte Allergene. Außerdem sollte der Test so ablaufen, dass weder Arzt noch Patient wissen, welches Nahrungsmittel gegeben wird. Das nennt man einen doppelblinden Test. Am besten gelingt das, wenn die Nahrungsmittel in einen Brei gerührt werden und wenn eine Assistentin den vorbereiteten Brei dem Patienten reicht. Geschmacksstoffe und Farben maskieren das Allergen zusätzlich.
Bei Verdacht auf diese Auslöser kann sich die Untersuchung lohnen:
- Arzneimittel
- Nahrungsmittel
- bei einer Pseudoallergie: Nahrungsmittel und Zusatzstoffe
Der subkutane Provokationstest
Hier spritzt der Arzt kleine Mengen eines Allergens unter die Haut am Oberarm. Nach einer Wartezeit von mindestens 20 Minuten steigert er die Dosis. So kann er zum Beispiel eine Überempfindlichkeit gegen örtliche Betäubungsmittel (Lokalanästhetika) erkennen. Typische Symptome sind zum Beispiel Quaddeln am gesamten Körper.
Der Stich-Provokationstest
Dieses Verfahren kommt nur für Patienten in Frage, die an einer Bienen- oder Wespengiftallergie leiden und bereits eine Immuntherapie gemacht haben. Auf der Station bringt der Arzt eine lebende Biene oder Wespe dazu, den Patienten zu stechen. Dann dokumentiert er die Reaktion. Der Test wird nur selten eingesetzt, weil er mehrere Nachteile hat:
- Es ist aufwändig, den Patienten auf der Station zu überwachen.
- Die Dosis lässt sich nicht schrittweise steigern.
- Die Giftmenge ist von Stich zu Stich unterschiedlich, der Test hat daher nur eine begrenzte Aussagekraft.
- Durch einen erneuten Stich kann sich eine Bienen- oder Wespengiftallergie verschlimmern.