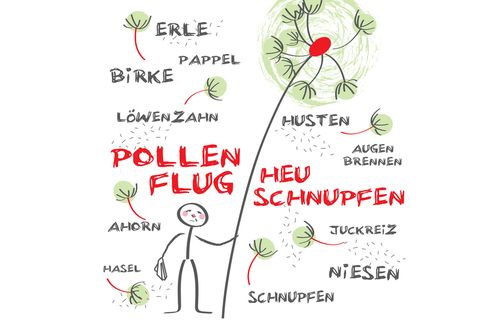Die Hyposensibilisierung ist die einzige Allergietherapie, die das Übel tatsächlich an der Wurzel packt. Ärzte nennen das Verfahren spezifische Immuntherapie (SIT) oder Allergie-Impfung, weil sie ähnlich wie eine Impfung funktioniert: Betroffene erhalten winzige Mengen des Allergens verabreicht, das in höherer Konzentration eine heftige Immunreaktion auslösen würde. Dank der geringen Dosis kann das Abwehrsystem aber langsam lernen, angemessen auf Pollen, Hausstaubmilben oder Insektengifte zu reagieren. Wie dieser Gewöhnungsprozess im Körper abläuft, ist noch nicht in allen Einzelheiten geklärt. Sicher ist aber: Fast immer findet er statt.
Eine Immuntherapie ist wirksam bei einer Allergie auf Gräser- und Baumpollen, Hausstaubmilben, Katzenhaare und Schimmelpilze. Sie hilft auch Menschen, die heftig auf Bienen- oder Wespenstiche reagieren. Auch Asthmatiker können von ihr profitieren, vor allem, wenn sie zusätzlich an Heuschnupfen leiden. Derzeit arbeiten Forscher an neuen Impfstoffen gegen Nahrungsmittel- oder Kontaktallergien, zum Beispiel gegen Latex.
Spritze, Tablette oder Tropfen
Meist geht die Hyposensibilisierung unter die Haut: Üblich ist eine Immunisierung mit Hilfe der Spritze. Ärzte nennen das subkutane Immuntherapie (SCIT). Dabei injiziert der Mediziner den Allergenextrakt an der Rückseite des Oberarms unter die Haut. Seit einigen Jahren gibt es auch eine angenehmere Alternative mit Tabletten oder Tropfen: die so genannte sublinguale Immuntherapie (SLIT). Dabei hält der Patient den Wirkstoff zwei bis drei Minuten unter der Zunge, bevor er ihn herunterschlucken darf. Diese Form der Immuntherapie ist noch nicht so gut erforscht wie die SCIT und hat sich bislang nur bei einer Allergie gegen Gräserpollen als wirksam erwiesen.
Die Therapie mit der Spritze besteht aus zwei Phasen. In den ersten Wochen injiziert der Arzt das Allergen einmal wöchentlich – jedes Mal etwas mehr, bis die größtmögliche Dosis erreicht ist. Danach bekommt der Patient die Allergenspritzen alle vier bis acht Wochen. So prägt sich das Immunsystem auf Dauer ein, dass es auf dieses Allergen nicht mehr zu reagieren braucht. Erst nach drei bis fünf Jahren ist die Behandlung abgeschlossen. Bessert sich die Allergie nach spätestens zwei Jahren überhaupt nicht, wird der Arzt die Therapie möglicherweise vorzeitig abbrechen. Die Behandlung birgt das Risiko einer allergischen Reaktion - manchmal nur als roter juckender Knubbel an der Einstichstelle, selten mit Kreislaufproblemen oder Übelkeit bis hin zum allergischen Schock.
Schneller geht es in der Anfangsphase mit einer Kurzzeit-Immuntherapie, die aus vier bis acht Injektionen vor der Pollenflugsaison besteht. Oder der Arzt verabreicht dem Allergiker zwei bis vier Injektionen an einem Tag und wiederholt dies nach ein oder zwei Wochen. Für eine dritte Variante müssen Betroffene in die Klinik gehen: Dort erhalten sie an zwei bis drei Tagen alle 30 bis 60 Minuten eine Spritze. Diese so genannte Rush-Immuntherapie ist sinnvoll für Menschen, die besonders heftig auf Insektengifte reagieren. Sie gewöhnen ihren Körper dann schnell an das Gift, und die Therapie dauert nicht Wochen und Monate, in denen weiterhin jeder Insektenstich lebensbedrohlich sein kann. Sie birgt aber ein deutlich höheres Risiko einer heftigen allergischen Reaktion. Mit Ausnahme der Rush-Immuntherapie bei Insektengiftallergie ist bislang unklar, ob die Schnellverfahren überhaupt Vorteile gegenüber der normalen Therapie haben.
Die sanftere Variante
Bei der SLIT bekommen Allergiker die Tabletten oder Tropfen in den ersten Wochen täglich verabreicht, danach zumindest mehrmals pro Woche. Verglichen mit der Spritze nehmen sie dabei eine deutlich größere Menge des Allergens zu sich. Auch diese Therapie kann Nebenwirkungen haben: Bis zu 70 Prozent der Allergiker klagen über Juckreiz im Mund oder eine geschwollene Schleimhaut. Manche klagen über Magen-Darm-Probleme.
Wer unter Heuschnupfen leidet, sollte mit der Hyposensibilisierung am besten im Herbst beginnen. Dann ist das Immunsystem im Frühjahr gut gerüstet. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob Sie während des Pollenfluges die Therapie unterbrechen oder die Dosis vermindern sollten. Auf diese Weise wird Ihr Immunsystem nicht doppelt belastet. Insgesamt dauert die Therapie im Allgemeinen drei Jahre. Manchen Insektengiftallergiker dagegen begleitet die spezifische Immuntherapie ein Leben lang, denn nur so kann er verhindern, dass der Körper die Gifttoleranz wieder verlernt - und der nächste Stich wieder lebensbedrohlich ist.
Voraussetzungen
Eine spezifische Immuntherapie ist empfehlenswert, wenn es für die Allergie ein entsprechend aufbereitetes Allergen gibt, dessen Wirksamkeit in Studien nachgewiesen ist. Der Arzt wird auch zur Hyposensibilisierung raten, wenn die Lebensqualität durch eine Allergie stark eingeschränkt ist - oder wenn sich die Allergie ausbreitet und ein Asthma droht. Diese Therapie ist außerdem sinnvoll, wenn Sie die Auslöser nicht gänzlich meiden können, wie beim Heuschnupfen.
Es gibt auch Gründe, die gegen eine Allergie-Impfung sprechen. Sie kommt nicht in Frage,
- wenn es Ihnen nicht möglich ist, regelmäßig beim Arzt zur Therapie zu erscheinen und nach der Behandlung noch eine halbe Stunde zur Beobachtung in der Praxis zu bleiben.
- wenn Sie unter schweren Herz-Kreislauf-Krankheiten leiden, vor allem, wenn Sie Betablocker einnehmen. Diese Medikamente wirken gegen Bluthochdruck, genau wie ACE-Hemmer, die eine Immuntherapie gegen Insektengifte unmöglich machen.
- wenn Sie an einer Überfunktion der Schilddrüse leiden.
- wenn Sie an einer chronischen Infektionskrankheit wie Tuberkulose oder chronischen Entzündungen durch Rheuma oder andere Autoimmunkrankheiten leiden.
- wenn bei Ihnen ein Immundefekt festegestellt wurde.
- wenn Sie an einem schweren allergischen Asthma leiden und Ihre Lungenfunktion eingeschränkt ist (die Einsekundenkapazität liegt unter 70 Prozent des Sollwertes).
- wenn bei Ihnen eine Krebserkrankung festgestellt wurde.
- wenn Sie an anderen schweren Krankheiten leiden.
Wirksamkeit
Am besten ist die Wirksamkeit der Hyposensibilisierung bei Heuschnupfen erforscht. Pollenallergiker hatten weniger Beschwerden und brauchen etwa nur noch halb so viele Medikamente. Ähnlich erfolgreich ist die Behandlung bei einer Hausstaubmilbenallergie. Hier ließen sich die Beschwerden und der Medikamentenverbrauch um etwa ein Drittel reduzieren. Bei einer Schimmelpilzallergie ist die Wirksamkeit nur durch wenige Studien belegt, ebenso wie bei einer Allergie gegen Katzen – für andere Tierallergene ist die Studienlage noch zu unsicher. Ansonsten kann die Behandlung bei leichtem allergischem Asthma empfohlen werden.
Besonders viel versprechend ist die spezifische Immuntherapie auch bei Allergien gegen Insektengifte: 75 bis 100 Prozent der Betroffenen sind die Überempfindlichkeit nach der drei bis fünf Jahre andauernden Behandlung los. Bei Menschen mit besonders schweren Stichreaktionen kann es dennoch sinnvoll sein, die Immuntherapie ein Leben lang beizubehalten, damit das Abwehrsystem die angemessene Reaktion auf das Gift nicht unbemerkt wieder verlernt.
Bei einer Nahrungsmittelallergie hilft die Therapie bislang nicht, bei der Neurodermitis wird der Erfolg noch in Studien untersucht.
Langzeiteffekt bei Tabletten und Tropfen unklar
Eine Hyposensibilisierung kann verhindern, dass sich die Allergie ausweitet: Einerseits entwickeln Allergiker nach der Therapie seltener weitere zusätzliche Allergien, andererseits breitet sich die Überempfindlichkeit des Immunsystems seltener von Nase und Rachen in die Bronchien aus. Aufgrund eines solchen Etagenwechsels erkrankt jeder dritte Pollenallergiker an Asthma. Die Immuntherapie kann vor allem Kinder davor schützen.
Bislang gibt es einige Studien zur Wirksamkeit von Tabletten oder Tropfen. Sie zeigen, dass vor allem Menschen mit Heuschnupfen, insbesondere gegen Gräserpollen, davon profitieren. Sie wird vor allem dann empfohlen, wenn eine SCIT nicht infrage kommt. Sprechen Sie ausführlich mit Ihrem Allergologen über die Vor- und Nachteile.
Risiken und Nebenwirkungen
Nebenwirkungen sind bei der SCIT sehr selten, kommen aber vor. Das Immunsystem kann mit heftiger Abwehr reagieren, bis hin zu Atemnot und allergischem Schock. Ein erfahrener Arzt bekommt solche Überreaktionen gut in den Griff, wenn er schnell eingreifen kann. Die meisten Zwischenfälle treten innerhalb von 30 Minuten nach der Injektion des Allergens auf. Bleiben Sie deshalb nach der Therapie noch mindestens eine halbe Stunde in der Praxis und sagen Sie Bescheid, falls Sie erste Symptome wie Schnupfen, Tränen und Jucken, Niesen oder Husten bemerken.
Die Einstichstelle kann zudem gerötet sein oder anschwellen. Meist verschwinden diese örtlichen Reaktionen schnell wieder von allein. Eine Überreaktion kann auch Stunden oder Tage nach der eigentlichen Behandlung auftreten. Achten Sie auf mögliche Vorboten und informieren Sie Ihren Arzt, sobald sie auftreten.
Bei Tropfen oder Tabletten sind bisher keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten, sondern nur Reaktionen im Mund - dafür sehr häufig: Bis zu 70 Prozent der so Behandelten klagt über diese Nebenwirkungen. Im Einzelnen sind das:
- Kribbeln und Brennen auf der Zunge oder im Rachen
- Juckreiz
- Eine geschwollene Schleimhaut
- Magen-Darm-Probleme
Tipps
Eine Hyposensibilisierung erfordert Geduld - auch wenn die Allergiesymptome bereits nach den ersten Wochen der Therapie weniger werden oder verschwinden. Nur wenn die Therapie über drei bis fünf Jahre konsequent erfolgt, kann sie dauerhaft helfen.
Bleiben Sie nach der Behandlung immer noch mindestens eine halbe Stunde in der Praxis, damit der Arzt bei einer allergischen Überreaktion schnell eingreifen kann. Teilen Sie Ihrem Allergologen außerdem rechtzeitig mit, wann Sie längere Reisen planen, so dass Ihr Behandlungsplan angepasst werden kann. Sagen Sie ihm, wenn weitere Schutzimpfungen nötig werden, wenn Sie neue Medikamente einnehmen müssen oder wenn Sie schwanger sind.
Schonen Sie sich am Tag der Behandlung. Sie können das Risiko von Nebenwirkungen oder Überreaktionen verringern, indem Sie vor und nach der Behandlung keine schwer verdaulichen Mahlzeiten essen und keinen Alkohol trinken. Vermeiden Sie außerdem schwere körperliche Arbeit, Sport, heißes Duschen und Saunagänge.
Expertenrat
Torsten Zuberbier, Professor für Allergologie an der Charité in Berlin und Experte des stern.de-Ratgebers Allergie, antwortet auf Ihre Fragen:
Kann ich zu alt für die Hyposensibilisierung sein?
Lange ging man davon aus, dass die spezifische Immuntherapie nur bei jungen Patienten wirksam ist. Heute weiß man: Wichtig für den Erfolg der Therapie ist nicht das Alter des Patienten, sondern, wie lange er bereits an der Allergie leidet. Die besten Chancen auf Besserung bestehen zu Beginn der Erkrankung, bevor sie womöglich bleibende Schäden an den beteiligten Organen (Schleimhäuten, Bronchien) verursacht hat. Die spezifische Immuntherapie kann also auch einem 70-Jährigen noch helfen - vorausgesetzt, er hat die Allergie erst seit drei bis fünf Jahren.
Muss ich die Immuntherapie während der Schwangerschaft unterbrechen?
Nein. Wenn Sie während einer bereits begonnenen Hyposensibilisierung schwanger werden, können Sie diese einfach fortsetzen - es sei denn, die Therapie hat bei Ihnen allergische Überreaktionen ausgelöst. Bei solchen Zwischenfällen müssen oft Medikamente gegeben werden, die Sie und das ungeborene Kind belasten können. Wer die Therapie vor der Schwangerschaft gut vertragen hat, kann dabei bleiben. Vor allem Insektengiftallergikerinnen sollten die Therapie nicht abbrechen, weil für sie und ihr Kind die Immunreaktion auf Insektenstiche gefährlicher ist als die sehr seltenen Nebenwirkungen. Um Ihren Körper nicht unnötig auf die Probe zu stellen, sollten Sie mit der Hyposensibilisierung allerdings nicht erst während einer Schwangerschaft beginnen.